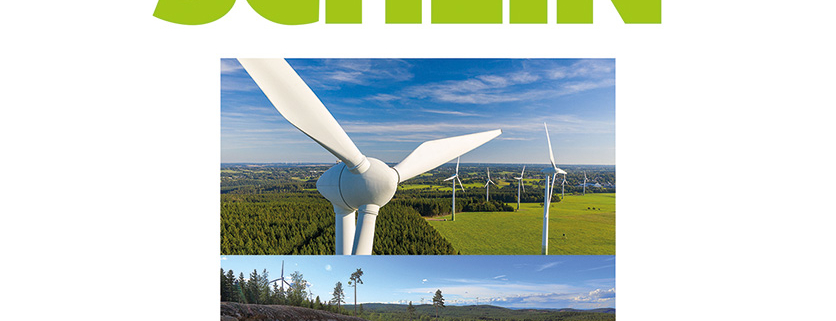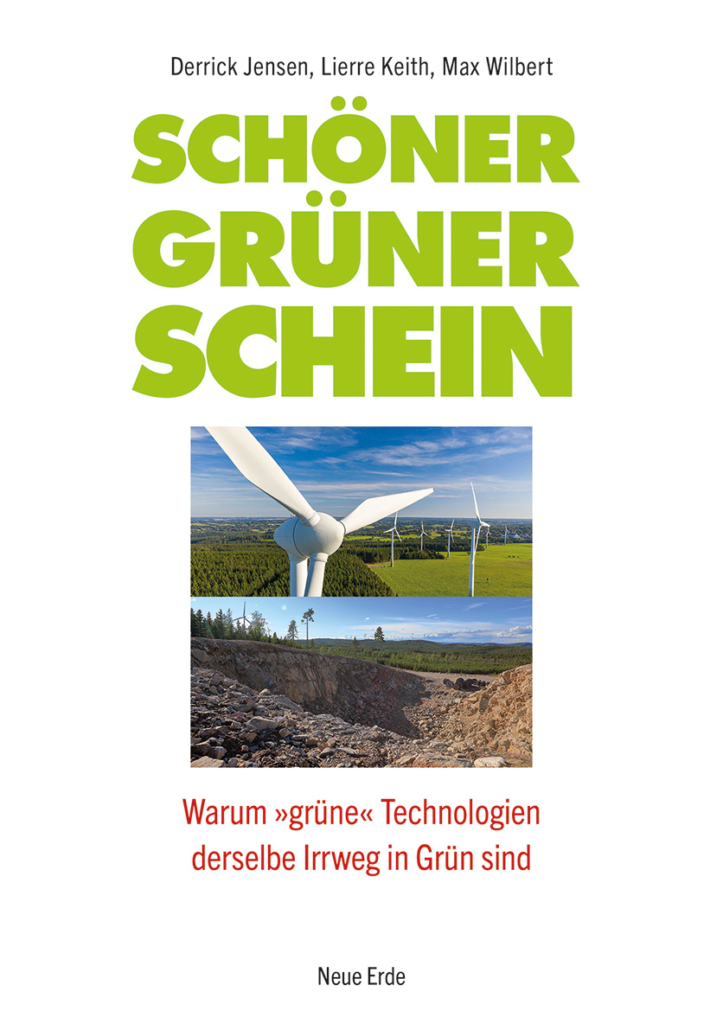von Dipl.-Ing. agr. Ulrike B. Rapp
Es klingt wie die Erfüllung eines ewigen Gärtnertraums: immer größeres und besseres Gemüse ernten, ohne Mehraufwand an Arbeit und ohne Düngung. Auf einer Kompostanlage in Griechenland ist dieses Phänomen aufgetreten. Es wird seit 20 Jahren von Fachleuten untersucht und ist nun reif für die breite Anwendung in der Praxis.
Die Geschichte beginnt mit dem Material einiger Kompostmieten, das im Jahr 2003 nicht in Säcke verpackt und verschickt werden konnte. Der Betreiber der Anlage ist Dr. Johannes Eisenbach, ein deutscher Landwirt und qualifizierter Agrarökonom, der sich seit den 90-er Jahren in Kalamata dem Olivenanbau widmet. Um die Bodenfruchtbarkeit in den Olivenhainen zu erhalten, hatte er begonnen, die Verarbeitungsrückstände nach dem Pressen des Olivenöls zu kompostieren, um sie seinem Agrarökosystem zurückzugeben. Der Kompost auf den 2003 liegengebliebenen Hügeln wurde nun so reif, dass sich darauf durch Flugsamen verbreitete Pflänzchen ansiedeln konnten. „Dann bauen wir jetzt eben Gemüse darauf an“, war die Folgerung des passionierten Agrarökonomen und so entstanden in der Kompostanlage Hügelbeete aus reinem, reifem Kompost. Jeder Gärtner weiß: Organische Substanz reduziert im Kompostierungsprozess ihr Volumen, und auch später im Gartenbeet oder auf dem Acker baut sich der Kompost langsam wieder ab. Doch auf der Kompostierungsanlage in Kalamata kam es in den Folgejahren des Gemüsesanbaus zu einer erstaunlichen Entdeckung: Die Komposthügelbeete verringerten ihre Masse nicht mehr und das Gemüse gedieh immer prächtiger. Eine 3 Kilogramm schwere, riesige Rote Beete versetzte die erfahrene Köchin der Kantine des Unternehmens in völliges Erstaunen: Solch eine wunderbar zarte Konsistenz und solchen hervorragenden Geschmack hatte sie bei dieser Größe niemals erwartet. Bei der Untersuchung des Substrats der Hügelbeete mit Feldmethoden stellte Dr. Eisenbach sodann fest, dass auch die Textur des Bodenmaterials nicht mehr der des gewöhnlichen Komposts entsprach; stattdessen war es nun ein erdiges Substrat. Das war der Beginn einer bewegenden Reise zur wissenschaftlichen Erklärung dieser fast unglaublichen Entdeckung, einer neuartigen Form stabiler, organischer Substanz mit außergewöhnlicher Düngewirkung, die später den Namen „Biozyklische Humuserde“ erhielt.
Humusaufbau in der Natur
Stabile, organische Substanz im Boden wird gewöhnlich als Dauerhumus bezeichnet. Dieser ist für die nachhaltige Fruchtbarkeit der Böden verantwortlich und entsteht normalerweise in Jahrtausenden vor allem in den Böden unter natürlichen Wäldern. Naturbelassene Wälder sind oft sehr artenreich und es erstaunt, dass all die verschiedenen Pflanzen, trotz ihrer unterschiedlichen Nährstoffansprüche auf demselben Boden gedeihen. Dies deutet auf eine in jüngster Zeit mehr und mehr in den Fokus wissenschaftlicher Studien rückende Beobachtung hin. Pflanzen nehmen nicht nur passiv die im Bodenwasser gelösten Nährstoffe auf (wie in einer Hydrokultur), sondern kommunizieren aktiv mit den Mikroorganismen in der unmittelbaren Nähe ihrer Wurzeln, der Rhizzosphäre. Sie bilden Symbiosen v.a. mit Bakterien und Pilzen, indem sie sie mit energiehaltigen Zuckerverbindungen „füttern“ und dafür von ihnen mit verschiedensten Formen auch hochmolekularer Nähstoffverbindungen versorgt werden. Über diese unglaublich komplexen Vorgänge zwischen Mikroorganismen und Pflanzen im Boden ist bisher noch wenig bekannt. Die Beobachtung aber, dass die Mikrobenkonzentration in der Rhizzosphäre (unmittelbare Umgebung der Wurzel) der Pflanzen im Vergleich zum umliegenden Boden um das 5- bis 50-fache erhöht ist, weist auf die enorme Bedeutung dieser Prozesse hin. Die Belebung des Bodens durch die Pflanzen – sozusagen im Kreislauf des Lebens, (oder Biozyklus, von bios (gr.) = Leben, und kyklos (gr.) = Kreislauf) – ist als der wesentliche Prozess für die Bodenbildung und damit dem Aufbau von Dauerhumus unter natürlichen Bedingungen anerkannt.
Auf dem Komposthügel mit Gemüseanbau
Anders als in natürlichen Ökosystemen mit ihren meist nährstoffarmen Böden, laufen nun diese prinzipiell gleichen Prozesse auf den nährstoffreichen Komposthügeln ab, die mit Gemüse bepflanzt werden. In reifem Kompost liegen die Nährstoffe jedoch in anderer Form vor als in einem gewöhnlichen Gemüsebeet oder einem Acker, der beispielsweise mit Mist gedüngt ist. In diesen „normalen“ Beeten und Äckern findet sich, eben aufgrund der damit verbundenen Düngepraxis, eine beträchtliche Menge der Nährstoffe frei verfügbar im Wasser des Bodens (Nährsalze in der Bodenlösung) gelöst und wird von den Pflanzen wie in der Hydrokultur durch Osmose aufgenommen. Im reifen Kompost hingegen sind die reichlich vorhandenen Nährstoffe fest in den organischen Strukturen gebunden. Eben dies veranlasst die Gemüsepflanzen, den oben beschriebenen Prozess, in der aktuellen Fachliteratur als „Kohlenstoffpumpe“ bezeichnet, einzusetzen. Die australische Wissenschaftlerin Christine Jones hat herausgefunden, dass die Pflanzen bis zu 50 % der von ihnen in der Photosynthese produzierten Zucker (= kurzkettige Kohlenstoffverbindungen) über ihre Feinwurzeln an den Boden abgeben. Diese „Energiepakete“ werden von Bakterien und Pilzen im Kompostbeet zerlegt, und die Pflanze kann im Gegenzug deren „Produkte“ aufnehmen und sich davon ernähren.
Struktur der Biozyklischen Humuserde
Als Nebenprodukt dieser Symbiose reichern sich im Boden im Verlauf der Zeit die „Reste der Energiepakete“ an, die von den Mikroorganismen nicht weiter verwertet werden können. Das sind niedermolekulare Kohlenstoffverbindungen, die man als „Krümel“ bezeichnen könnte. Da Kohlenstoff bekanntermaßen die Fähigkeit besitzt, sehr stabile, kristalline Strukturen (wie Diamant oder Graphit) zu bilden, kann nun aus diesen Reststücken eine besondere, amorphe oder vermutlich sogar vorkristalline Kohlenstoffstruktur entstehen. Diese sind es, die das erdähnliche Substrat, das Dr. Eisenbach nach einigen Jahren auf den bepflanzten ehemaligen Komposthügeln fand, zu biozyklischer Humuserde mit bisher unbekannten Eigenschaften macht.
Bemerkenswert ist, dass es sich hierbei um einen autodynamischen oder sich selbst verstärkenden Prozess handelt, denn diese amorphen oder vorkristallinen Strukturen im Boden bilden den idealen Lebensraum für die Mikroorganismen selbst. Sie zeichnen sich durch kleine Zwischenräume (Poren) aus, in denen sich die Feuchtigkeit hält, wie auch durch größere, in denen die Luft zirkulieren kann, d. h. der Boden kann „atmen“. Die Pflanzen pumpen also fortwährend Kohlenstoff in den Boden, leben in Symbiose mit ihren Mikrobengemeinschaften, und aus den Reststoffen formt sich immer neuer Lebensraum für diese. So erklärt sich nach bisherigem Forschungsstand ein kontinuierliches Wachstum des lokalen Bodenmikrobioms und damit die in der Praxis beobachteten stetig steigenden Ernteerträge, sowie die außergewöhnliche Qualität der Lebensmittel. Die eindrucksvollen Ertragssteigerungen konnten bisher schon in zwei Experimenten an den Universitäten Athen¹ und Berlin² wissenschaftlich bestätigt und im Rahmen von Masterarbeiten publiziert werden.

Biozyklische Humuserde
*ENTSTEHUNG: durch mehrjährige Bepflanzung der Hügel des vollreifen Komposts. (= PCS, siehe Erklärung im Textfeld unten) mit möglichst vielfältigen Mischkulturen, nach dem Vorbild der Natur. So entsteht aus PCS die biozyklische Humuserde in für die Veredelung biozyklischer Humuserde zertifizierten Gemüsebaubetrieben.
* EIGENSCHAFTEN:
– keine Auswaschung von Nährstoffen
-voll pflanzenverträglich in allen Entwicklungsstadien
– unerwartet hohe Ernten, von Jahr zu Jahr steigend, wenn die Kulturpflanzen auf reiner Humuserde ohne Bodenzusätze und unter Verzicht jeglichen wasserlöslichen Düngers angebaut werden
Die Qualität der Lebensmittel in der weltweiten Bodenkrise
Diverse Untersuchungen deuten darauf hin, dass der Gehalt unserer Lebensmittel an lebenswichtigen Mineralien und Spurenelementen seit Jahrzehnten kontinuierlich sinkt. Neben anderen Faktoren kann dies den Anstieg verschiedenster in den letzten Jahren zunehmender Erkrankungen zumindest teilweise erklären. Die australische Bodenbiologin Dr. Christine Jones führt den Nährstoffverlust in Lebensmitteln auch auf den schlechten Zustand der Böden zurück, auf denen diese Lebensmittel produziert werden. Weltweit haben landwirtschaftliche Flächen durch den Einsatz von Agrarchemikalien bereits 30-70% des Kohlenstoffgehalts und damit einen beträchtlichen Anteil des Humusgehalts und des Bodenlebens verloren.
Es versteht sich von selbst, dass Lebensmittel, die auf biozyklischer Humuserde angebaut werden, von unvergleichlich besserer Qualität sind. Auf der von intensivsten Lebensprozessen so erfüllten, biozyklischen Erde wachsen biotisch einzigartige Nahrungsmittel von höchstem Wert für die menschliche Gesundheit.
Verbreitung der Biozyklischen Humuserde
Seit einigen Jahren arbeitet das Team um Dr. Eisenbach kontinuierlich daran, die Rahmenbedingungen für die weltweite Verfügbarkeit von Biozyklischer Humuserde zu schaffen. „Es war eine große Herausforderung, eine Organisation aufzubauen, die sowohl die Beschaffung der für die Steigerung der Produktion von PCS erforderlichen Mittel verwaltet als auch den Produktionsprozess in allen Schritten überwacht und dokumentiert“, erklärt Dr. Eisenbach. PCS (Phytoponic Compost Substrate, von phytho (gr.)= Pflanze, und ponos (gr.) =Arbeit, Mühe) ist vollreifer Kompost rein pflanzlicher Herkunft und nach bisherigen Erkenntnissen unabdingbar als Ausgangsmaterial für die Entstehung von Biozyklischer Humuserde.
Der anfängliche Kompostierungsprozess wird nach streng definierten Parametern gesteuert; es müssen unter anderem Temperatur, Feuchtigkeit und CO2 Gehalt ständig überwacht werden, damit der Kompost zum richtigen Zeitpunkt gewendet werden kann. Beim Wenden wird die Kompostmiete sozusagen belüftet, damit die Mikroorganismen nach dem Vorbild der Natur zu jedem Zeitpunkt genügend Sauerstoff für ihre Arbeit zur Verfügung haben. Ein solch komplexes Verfahren kann in der Regel am besten in professionellen Kompostierungsanlagen gewährleistet werden, in denen zusätzlich die Verbleibdauer des Kompostes bis zur Vollreife verlängert ist. Die erforderlichen, finanziellen Mittel dafür bereitzustellen, ist das Ziel der Bemühungen von Dr. Eisenbachs Team. Anschließend soll in zertifizierten gärtnerischen Betrieben die Bepflanzung mit Mischkulturen erfolgen, mittels derer dann der vollreife Kompost (PCS) in bis zu 5 Jahren zur Biozyklischen Humuserde „veredelt“ wird. Es könnte einen interessante Alternative für viele Betriebe sein, da ihnen das PCS unentgeltlich für die Dauer der Veredelung zur Verfügung gestellt wird. Das darauf geerntete Gemüse können sie selbständig vermarkten, wobei die Einhaltung der biozyklisch-veganen Richtlinien, genau wie bei anderen biologischen Anbauverbänden, jährlich kontrolliert wird. Wenn der Veredelungsprozess abgeschlossen ist, wird zusammen mit den an der Schaffung der finanziellen Grundlagen für die Entstehung der Biozyklischen Humuserde Beteiligten über die weitere Verwendung entschieden, Einzelheiten dazu sind im Terra-Plena-Fonds geregelt. Natürlich kann die veredelte Humuserde dann auch in landwirtschaftlichen Betrieben genutzt werden.
Phythoponisches Compost Substrate (PCS) ≈ vollreifer Kompost
*ENTSTEHUNG: aus überwachtem und gesteuertem Kompostierungsprozess aus rein pflanzlichen Ausgangsmaterialien auf einer Kompostanlage oder einem spezialisierten land- oder gartenbaulichen Betrieb entsteht reifer Kompost. Dieser wird weiter in der Miete gelagert bis er sich auf natürliche Weise begrünt und so zur Vollreife kommt.
*EIGENSCHAFTEN:
– es kann zur Auswaschung sehr geringer Nährstoffmengen kommen
– voll pflanzenverträglich, muss für Bepflanzung nicht mit Erde vermischt werden
– gute Erträge
Der Terra-Plena-Fonds
Als finanzieller Mechanismus, der die weltweite Verbreitung Biozyklischer Humuserde ermöglichen soll, wurde der Terra-Plena-Fonds geschaffen. Investoren werden hier zu „Bodenkuratoren“, die mitwirken an der Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und damit der Sicherung der Welternährung. Eine Wertsteigerung der Fondsanteile ist zunächst mit der steigenden Nachfrage nach fruchtbarer Erde zu erwarten. Auch sollen in Zukunft CO2-Zertifikate auf die Entstehung Biozyklischer Humuserde ausgestellt werden. Es wurde errechnet, dass die Erzeugung von 2,5 Tonnen Biozyklischer Humuserde auf zertifizierten Veredelungsflächen etwa 1 Tonne CO2-Äquivalente bindet. Des Weiteren ist geplant, eine naturwertbasierte dezentrale „Fruchtbarkeitswährung“ terra libra bereitzustellen, die auf einem Blockchain-basierten Marktplatz verfügbar ist. Eine elektronische Währung, die sich durch einen stabilen, natürlichen Wert auszeichnet und mit der gesunde, schmackhafte und biologisch nährstoffreiche Lebensmittel angebaut und erworben werden können, ist eine absolut neuartige Möglichkeit der Zukunftssicherung.
Vielfältige Mitwirkungsmöglichkeiten
Wir leben in Zeiten, in denen die menschliche Gesundheit besonders bedroht scheint und der Zusammenhang mit der belasteten Umwelt sowie der Zerstörung insbesondere der Bodenfruchtbarkeit nahezu allseitig anerkannt ist. Umso wichtiger wird es, natürliche, im Kreislauf des Lebens entstandene, fruchtbare Erde als universelle Existenzgrundlage zu erkennen, ihren Wert zu schätzen und zu fördern. Bleibt zu wünschen, dass die Entdeckung auf den Komposthügeln von Kalamata, im Zusammenwirken interessierter Personen und Organisationen möglichst schnell dazu beitragen kann, Gartenbau und Landwirtschaft zu einer lebensfördernden Praxis zu transformieren.
________________
¹Eisenbach L.D. et al. (2018): Effect of Biocyclic Humus Soil on Yield and Quality Parameters of Sweet Potato (Ipomoea batatas L.). Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LXI, No. 1, 2018. S.210-217
²Schubert, Anna: Masterarbeit an der Humboldt-Universität Berlin, März 2023, Stickstoffdüngewirkung veganer organischer Reststoffe durch einen Gefäßversuch mit Deutschem Weidelgras (Lolium perenne L.)
|
|
| Auch Sie können zur Entstehung von mehr Biozyklischer Humuserde beitragen, sei es in Ihrem privaten oder gewerblichen Garten, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb oder als Bodenkurator mit Ihrer Investition in den Terra-Plena-Fonds, vielleicht haben Sie auch persönliche Verbindungen, Kenntnisse und Fähigkeiten, die das Projekt weiterbringen können.
Bitte kontaktieren Sie Frau Dipl.-Ing. agr. Ulrike B. Rapp, E-Mail: ulrikebrapp@gmail.com |
|






 „Die meisten Leute in Mitteleuropa“, sagt er, „stellen sich Guatemala viel unterentwickelter vor, als es tatsächlich ist. Dabei kann man in diesem Land wunderbar Fuß fassen und leben. Und die meisten Menschen hier, überwiegend Indigene, sind freundlich und entgegenkommend. Natürlich sollte man bereit sein, Spanisch zu lernen.“
„Die meisten Leute in Mitteleuropa“, sagt er, „stellen sich Guatemala viel unterentwickelter vor, als es tatsächlich ist. Dabei kann man in diesem Land wunderbar Fuß fassen und leben. Und die meisten Menschen hier, überwiegend Indigene, sind freundlich und entgegenkommend. Natürlich sollte man bereit sein, Spanisch zu lernen.“ uatemala einen Mindestlohn von 3200 Quetzales. Er kenne aber, von ihm selbst abgesehen, niemanden, der das bezahlt – kontrolliert werde das in aller Regel nämlich nicht. Er selbst bezahle das als Einstiegsgehalt; Mitarbeiter, die länger bleiben, erhalten deutlich mehr. EuropäerInnen könnten, findet er, in Guatemala locker einen Job finden – und würden in der Regel, wegen ihrer anderen Fähigkeiten und ihrer höheren Verlässlichkeit, besser bezahlt. „Ein Arbeitsamt oder etwas Vergleichbares gibt es hier aber nicht. Man muss einfach losgehen und quatschen. Außerdem gibt es zu praktisch jedem Ort eine Facebook Community. Darüber sind die Leute krass connected.“ Seine Freundin sei da zum Beispiel in einer Mütter-Gruppe. Einer unterstützt den anderen. „So viel Zusammenhalt hast du in Berlin nicht. Für Mütter ein paar Wochen vor der Geburt und ein paar Monate danach gibt es zum Beispiel den ‚Food Train‘. Da kochen andere abwechselnd in der Nachbarschaft für dich mit und bringen dir das Essen vorbei – alles umsonst, ohne Erwartung auf eine Gegenleistung. Ich bin ja nicht unbedingt der Freund der Hippies hier, aber so was haben sie drauf, das ist guter alter Hippiespirit.“
uatemala einen Mindestlohn von 3200 Quetzales. Er kenne aber, von ihm selbst abgesehen, niemanden, der das bezahlt – kontrolliert werde das in aller Regel nämlich nicht. Er selbst bezahle das als Einstiegsgehalt; Mitarbeiter, die länger bleiben, erhalten deutlich mehr. EuropäerInnen könnten, findet er, in Guatemala locker einen Job finden – und würden in der Regel, wegen ihrer anderen Fähigkeiten und ihrer höheren Verlässlichkeit, besser bezahlt. „Ein Arbeitsamt oder etwas Vergleichbares gibt es hier aber nicht. Man muss einfach losgehen und quatschen. Außerdem gibt es zu praktisch jedem Ort eine Facebook Community. Darüber sind die Leute krass connected.“ Seine Freundin sei da zum Beispiel in einer Mütter-Gruppe. Einer unterstützt den anderen. „So viel Zusammenhalt hast du in Berlin nicht. Für Mütter ein paar Wochen vor der Geburt und ein paar Monate danach gibt es zum Beispiel den ‚Food Train‘. Da kochen andere abwechselnd in der Nachbarschaft für dich mit und bringen dir das Essen vorbei – alles umsonst, ohne Erwartung auf eine Gegenleistung. Ich bin ja nicht unbedingt der Freund der Hippies hier, aber so was haben sie drauf, das ist guter alter Hippiespirit.“ „Praktisch ist, dass du hier keine Arbeitsgenehmigung brauchst“, betont Philip. Die sei mit der Einreise nach Guatemala automatisch erteilt – was auch bedeutet, dass man hier sein eigenes Business gründen kann. „Du gehst dann zur Steuerbehörde und beantragst eine Steuernummer bzw. zusätzlich eine Wirtschaftssteuernummer. Dann kann es schon losgehen.“ Um von der weitverbreiteten Korruption wegzukommen, hat der Staat vor Kurzem noch eine Regelung eingeführt: „Sobald du etwas kaufst, was teurer als 2500 Quetzales ist, musst du beim Kauf deine Steuernummer angeben oder, wenn du keine hast, deine Passnummer. So konsequent ist man nicht einmal in Deutschland.“
„Praktisch ist, dass du hier keine Arbeitsgenehmigung brauchst“, betont Philip. Die sei mit der Einreise nach Guatemala automatisch erteilt – was auch bedeutet, dass man hier sein eigenes Business gründen kann. „Du gehst dann zur Steuerbehörde und beantragst eine Steuernummer bzw. zusätzlich eine Wirtschaftssteuernummer. Dann kann es schon losgehen.“ Um von der weitverbreiteten Korruption wegzukommen, hat der Staat vor Kurzem noch eine Regelung eingeführt: „Sobald du etwas kaufst, was teurer als 2500 Quetzales ist, musst du beim Kauf deine Steuernummer angeben oder, wenn du keine hast, deine Passnummer. So konsequent ist man nicht einmal in Deutschland.“