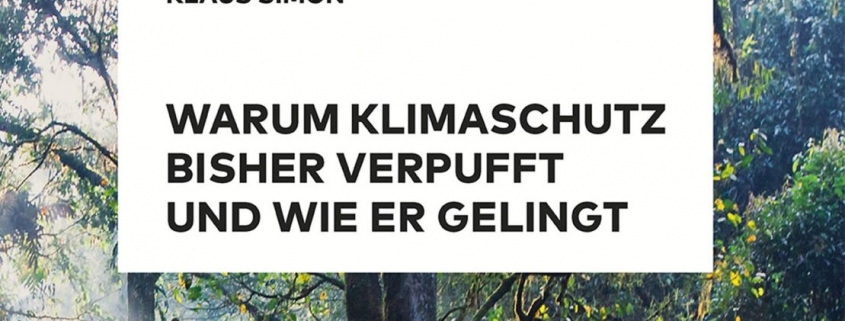von Peter Zettel
Natürlich bei meinem eigenen. Wo auch sonst? Wir reden zwar oft darüber, bewusst zu sein und über Bewusstsein, doch selten sprechen wir darüber, was wir eigentlich darunter verstehen. Betrachten ich und ein anderer die identische Szene, dann bedeutet das noch lange nicht, dass wir wirklich das Selbe und oft auch nicht das Gleiche sehen, denn was wir wahrnehmen können ist ja davon abhängig, was wir über die Situation denken.
Raum oder Nichtraum?
Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Es fängt ganz banal an bei dem Raum, in dem ich lebe. Ist er für mich dreidimensional und lässt sich alles, was wirklich ist, anhand der Dimensionen von Länge, Breite und Höhe beschreiben? Oder ist Raum etwas ganz anderes für mich? Ist er offen und beweglich in der Zeit und lässt sich alles, was wirklich ist, nur dann beschreiben, wenn ich den Raum als gestaltbar ansehe?
Die erste Raumdefinition passt natürlich perfekt auf mechanische Dinge. Doch dann ist damit auch schon Schluss. Alles Lebendige geschieht nämlich nach der zweiten Version der Bewusstseinsbeschreibung. Das Problem dabei ist allenfalls, dass derart viele Faktoren eine Rolle spielen, so dass man sich leicht dazu verleiten lässt, diese Offenheit und Beweglichkeit nicht zu beachten.
Unmittelbar wahrnehmen lässt sie sich in der Regel kaum. Doch ich halte es für fatal, das dann einfach zu ignorieren; so nach der Maßgabe „was ich nicht sehen kann gibt es auch nicht“. Mein gesamter Körper bis hin zum Denken funktioniert leider nicht wie eine Maschine.
Wäre vielleicht auch langweilig. Wie dem auch sei, es gibt eine Menge Gründe, sich damit zu beschäftigen. Und zwar ganz ernsthaft. Mein Verständnis von Bewusstsein hat wie jedes andere auch das eigene Weltbild als Basis. Das zu wissen ist wichtig. Sehe ich das klassische Weltbild als gegeben an, komme ich zu ganz anderen Sichtweisen als etwa ein Quantenphysiker.
Differenziert, aber nicht getrennt
Es gibt für mich keinen Unterschied zwischen dem Kosmos und mir. Schließlich ist ja alles Lebendige aus anorganischer Materie hervorgegangen. Mittlerweile wissen wir ja auch, dass Materie irgendwie alles andere als leblos ist.
Und genau deswegen taste ich mich mit meinem Denken in diesen offenen, prozesshaften Bewusstseinsraum. Erst einmal versuche ich, mein Denken zu begreifen, dann den Rest von mir. Mal sehen, was dann passiert. Also beginne ich damit, folgendes nicht mehr zu glauben: Subjekt und Objekt sind grundsätzlich voneinander getrennt. Ich erlebe mich als eigenständige Persönlichkeit und bin mit belebten und unbelebten Objekten nicht verbunden.
Sondern ich sehe es so: Es gibt weder Subjekt noch Objekt, Dinge sind nur differenziert, nicht aber voneinander getrennt. So existiere ich nicht aus mir selbst heraus, bin weder eigenständig noch getrennt, sondern ich bin mit allem verbunden, was ist. Gerade die Tatsache, dass alles verbunden ist, ist nicht so einfach zu realisieren.
Blind verbunden
Doch das kann ich nicht intellektuell verstehen, ich muss mich auf diese Gedanken einlassen. Nur dann beginnen sie, sozusagen in mir zu arbeiten, denn nur dann kann ich auch die entsprechende Erfahrung machen. Um die geht es nämlich: Die Erfahrung. Ohne die bleibt es immer nur ein gedanklicher Sturm im Wasserglas.
Wir sind nämlich nicht wie mit einer Schnur miteinander verbunden, sondern auf eine ganz andere Art. Die Verbundenheit bezieht sich vor allem auf eine unmittelbare Interaktion, die ich früher oft nicht wahrgenommen oder schlicht ausgeblendet hatte. Es ist eben wie mit dem Meer und der Gischt. Das unbewegte Meer ist das eine, die Gischt entsteht daraus und kehrt auch wieder dorthin zurück.
Manchmal versteht man sich blind. Diese Verbundenheit ist gemeint. Wenn der eine jedoch partout nicht will, dann gibt es eben keine Verbundenheit, erst wieder, wenn die Gischt erneut zum Meer geworden ist. Am klarsten sieht man dies bei einem Tanz. Tänzer und Tänzerin sind von einander differenziert, doch im Tanz werden sie eins, wenn sie sich darauf einlassen.
Die Voraussetzung dafür ist, dass sie ihre gedankliche, auf das „Ich“ reduzierte Gedanken-Hülle verlassen und zum Tanz werden. Nicht-Eins, Nicht-Zwei; Nicht-Zwei, Nicht-Eins. Was die alten Ch‘an-Menschen, hier Dogen Zenji, schon sagten, bestätigen uns heute die Erkenntnisse der Quantenphysik, nur eben pragmatischer.
Den Weg studieren bedeutet, sich selbst studieren.
Sich selbst studieren bedeutet, sich selbst vergessen.
Sich selbst vergessen bedeutet, in Harmonie zu sein mit allem, was uns umgibt.
Für mein egozentriertes Leben eine echte Herausforderung. Aber eine wahrhaftige Erlösung, wenn ich es einmal begriffen habe. Nur ist es absolut wichtig, mich nicht von irgendwelchem esoterischen Gesülze einfangen zu lassen.