Design für die Rettung der Welt – so der Anspruch eines kürzlich erschienenen Buches
„Wie können wir es schaffen, mit zehn bis zwölf Milliarden Menschen gut auf dieser Erde zu leben? Wie erreichen wir für alle ein Leben in angemessenem Wohlstand, in Frieden und Freiheit und in einem global intakten und vielfältigen Ökosystem?“ Jascha Rohr
Von Bobby Langer
Könnte man den geläufigen Ausdruck „das Buch der Stunde“ auf eine ganze Epoche übertragen, dann träfe er auf dieses Buch zu. Es erhitzt sich nicht an – immer diskutablen – Inhalten, sondern beschäftigt sich klug, systematisch und auf viel Erfahrung zurückgreifend mit den uns bleibenden Möglichkeiten, das Ruder herumzureißen.
Der Autor Jascha Rohr beschreibt sein Buch folgendermaßen: „Wir haben einen kokreative Werkstatt in Form eines Buches vor uns, die aus einer Reihe von Werkräumen besteht, den Kapiteln dieses Buches. Unser Ziel ist der Entwurf für die große Kokreation.“
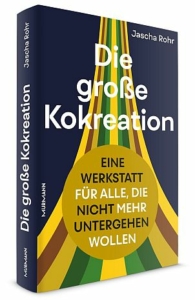 Kein Was ohne Wie
Kein Was ohne Wie
Für viele Laien, aber auch Experten in Sachen Nachhaltigkeit, Erderwärmung oder Artensterben sieht es eher hoffnungslos aus. Gleich dem vom Auge der Schlange gebannten Kaninchen stehen sie dem lebensverschlingenden Verhalten der industriellen Zivilisation ratlos gegenüber. Jascha Rohr hat – wenigstens für sich – diesen Bann gebrochen. Statt sich dystopischen Gedanken zu überlassen, überlegt er, wie eine nachhaltige Umgestaltung der Welt funktionieren könnte. Denn, so findet er, ohne über das Wie nachgedacht zu haben, brauchen wir uns über das Was erst gar keine Gedanken zu machen. „Die große Kokreation“ ist für ihn ein „Entwurf darüber, wie wir unsere globalen Probleme besser miteinander lösen können“. Die Zukünftigen lässt er rufen: „Stellt euch den Herausforderungen und Schwierigkeiten, entwickelt positive Wirkung. Baut auf das, was euch Kraft gibt und im besten Sinne wirkmächtig macht – auf eure Lebendigkeit, Kreativität, Freude und Liebe, eure Lust, Begeisterung, Intelligenz und Empathie.“
Nicht nur lesenswert, sondern auch lesbar
Rohrs Buch ist eine „Werkstatt für alle, die nicht mehr untergehen wollen“ – so der Untertitel. Das kann nicht anders als komplex und auf hohem theoretischen Niveau angegangen werden. Und doch gelingt es dem Autor, sich dem großen Thema klar, übersichtlich und auch sehr persönlich und menschlich zu nähern. Mit anderen Worten: Man muss nicht Sozialwissenschaften studiert haben, um es lesen zu können. Dazu trägt bei, dass Jascha Rohr sowohl induktiv wie deduktiv arbeitet; d. h. manchmal begibt er sich von einem praktischen Beispiel ausgehend auf die Metaebene, manchmal startet er gedanklich auf der Metaebene und belegt seine Gedanken durch ein Beispiel. Selbst die Grafiken sind dank ihrer Skizzenhaftigkeit besser nachvollziehbar und einprägsamer, als dies „perfekte“, theoriebezogene Grafiken normalerweise sind. Und noch eines macht sein Buch lesenswert: Es ist getragen von dem unbedingten Willen, Positives in die Welt zu bringen – ohne die Augen vor den drängenden Problemen zu verschließen.
Methoden zur Neuerfindung der planetaren Zivilisation
Entscheidend für Jascha Rohr: Es geht nicht um fertige inhaltliche Lösungen, sondern um die „Beschreibung des Wie …, also eines Prozesses. Dieser Prozess hat im Grunde längst schon begonnen … Es ist ein Prozess, in dem wir miteinander lernen, unsere Probleme ganz anders zu lösen, als wir es bisher versuchen … Das Ziel ist nichts Geringeres als die Neuerfindung unserer planetaren Zivilisation.“ Ein hoher Anspruch.
Die zentrale Methode für dieses „Global Resonance Project“ nennt er „Resonanzarbeit“. Und das ähnelt keiner bekannten Methode, ganz im Gegenteil: „Resonanzarbeit folgt keiner festen Strategie, sondern ist mäandernd, verknüpfend, assoziativ. Sie stellt vielfältige Verbindungen und Beziehungen her, um Kreativität, Ideen und Innovationen anzuregen. Im Idealfall entsteht daraus am Ende ein kokreativer Entwurf.“ Der Prozess ist „entwurfsorientiert. Er ist ein Angebot zum Selbstdenken, zum Entwickeln und Mitgestalten … [Das Buch] bietet die Möglichkeit der Auseinandersetzung in einem Feld – in diesem Fall ist das die planetare Zivilisation –, damit dann aus dem eigenen Impuls heraus und mit den eigenen Potenzialen und Möglichkeiten transformatorische Projekte entwickelt und in die Umsetzung gebracht werden können, sodass am Ende eine reale Veränderung in der Welt entsteht“.
Aus einem alten Hut wird kein neuer
Jascha Rohr geht es um zwei Fragen:
„Wie kann es sein, dass wir als Spezies unsere eigenen Lebensgrundlagen zerstören?“
Und: „Was kann Kokreation dazu beitragen, dass sich diese Dynamik zum Positiven wendet?“
Der Leser kann, wenn er möchte, mitverfolgen und dabei erlernen, wie sich Methoden in kokreativen Prozessen kontextspezifisch aus dem Prozess entwickeln und ist eingeladen, „in der eigenen Praxis mit diesen Ansätzen zu experimentieren“. Personen, die an eigenen Prozessen und Projekten arbeiten, empfiehlt Jascha Rohr, das Buch mit dem eigenen Projektteam zu lesen.
Klar: „Benutzen wir … die Werkzeuge der alten Zivilisation, kann nur eine neue Version der alten Zivilisation dabei herauskommen.“ Um diesem Fehler nicht zu erliegen, kommt die Kokreation ins Spiel, ein Wort, das der „Kooperation“ oder „Kollaboration“ ähnelt, sich aber deutlich davon unterscheidet. So bezieht sich das „Ko“ in Kokreation nicht nur auf Mitmenschen, sondern auf die gesamte Mitwelt, also auf alle Mitgeschöpfe, auch: Mitdinge. Es geht darum, Mittel und Wege zu finden, „mit der gesamten Welt gemeinsam zu gestalten, statt die gesamte Welt als Menschen zu gestalten“. Das klingt in der Tat nicht mehr nach einem „Werkzeug der alten Zivilisation“. Der Wortteil „kreation“ in Kokreation bezieht sich auf Kreativität als Grundlage von Emergenz in Kunst und Kultur, wozu unbedingt auch Architektur, Philosophie, Ingenieurskunst und Wissenschaft gehören. Anders als in der alten Zivilisation lässt sich in einem kokreativen Entwurfsprozess „meist gar kein klares Ergebnis definieren, sondern eher einen Ergebnistyp“. Auf der Suche nach neuen Lösungsansätzen werden „die Themen, Akteure und Kontexte aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und zueinander in Beziehung gesetzt“.
Das ontologische Grundproblem angehen
Der Vater aller Probleme ist der Subjekt-Objekt-Dualismus, den Jascha Rohr als „ontologisches Grundproblem der ökologischen Krise“ identifiziert. Um sich von ihm zu lösen, sind die entscheidenden begrifflichen Werkzeuge:
Das Feld: „die räumliche Konstellation von miteinander interagierenden Partizipateuren und ihre Wirkungen aufeinander“ (auch: „die Wirkungen und Kräfte, die sich zwischen den Elementen aufspannen“). Anders als „Systeme“ sind Felder nicht durchschaubar und nicht steuerbar.
Der Prozess: „die sich zeitlich entfaltende Dynamik eines Feldes“, bestehend „aus allen diesen Prozess prägenden Partizipateuren, deren Wirkungen und Interaktionen sowie der fortschreitenden generativen Entwicklung, die daraus resultiert“. Besonders wichtig und auch schon in kleinem Rahmen anwendbar und aufs Größere übertragbar: „Prozesse sind fraktal und verschachtelt.“ Zur Erklärung des damit Gemeinten: „Unser Leben ist ein Prozess, aber unsere Ausbildung, Beziehungsphasen und die Phasen, in denen wir einer bestimmten Profession nachgehen, sind ebenfalls Prozesse.“
Indem Rohr die Begriffe „Subjekt“ und „Objekt“ abschafft und durch „Partizipateur“ ersetzt, schafft er die gedankliche Voraussetzung für einen tatsächlich ontologischen Paradigmenwechsel: „Alle Dinge der Welt sind Dinge der Welt, weil sie an der Welt teilhaben.“ Folgerichtig können auch „eine Geschichte, eine Kaffeetasse, eine Blume und die Gravitation“ Partizipateure sein: „Alles in der Welt ist Partizipateur, wenn es wirkt und teilhat. Was nicht wirkt und an nichts teilhat, existiert nicht.“
Zusammenfassend: „Ein Feld ist ein Prozess zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ein Prozess ist ein Feld in seiner dynamischen Entfaltung.“ Die große Aufgabe, die Zukunft zu gestalten, kann folglich kein „funktionales Gestalten“ sein – das wäre das Übliche –, sondern „ein generatives, wechselseitiges, fluides Interagieren mit den Prozessen, die uns gestalten, während wir gestalten“. Erst wenn wir „die Dinge in ihrer jeweiligen intrinsischen Eigenart als Gegenüber anerkennen“, wird tatsächlich ein Ausweg aus dem Subjekt-Objekt-Dualismus vorstellbar hin zu einer ökologischen, kokreativen Demokratie.
Die dazu fähige und dafür notwendige Kulturtechnik ist die Kokreation. „Sie ist das Wie: Wie gestalten wir gemeinsam. Das Was ergibt sich dann daraus … das wird synchron passieren: Wir werden diese erst in den Anfängen sichtbare Kulturtechnik entdecken, entwickeln, erfinden, erlernen und trainieren müssen, während wir beginnen, sie anzuwenden und erste Ergebnisse zu produzieren.“
Und das ist dabei die Herausforderung: „Da rollt die phantastischste Wahnsinnswelle auf uns zu, die wir je haben reiten können. Der Einsatz ist hoch, die Welle gefährlich, möglicherweise tödlich, aber der Ritt, den wir nehmen könnten, kann der beste unseres Lebens werden.“ Sich dem zu stellen, ist eine gewaltige und riskante Aufgabe mit ungewissem Ausgang. Das schätzt auch Jascha Rohr so ein und gesteht: „Dieses Buch ist ein Wagnis und der Versuch, eine visionäre Geschichte zu erzählen.“ Ihm zuzuhören, ist fesselnd und lädt ein, dabei zu sein beim „planetaren Fest der Gestaltung“.
Jascha Rohr, Die große Kokreation. Eine Werkstatt für alle, die nicht mehr untergehen wollen. 400 S., 39 Euro, Murmann Verlag, ISBN 978-3-86774-756-1
→ Interview mit Jascha Rohr
→ Internetseite zum Buch



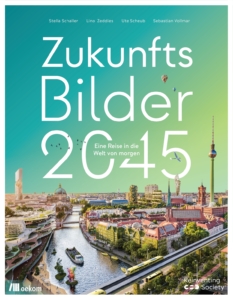 Doch bevor dieses in seiner Art einmalige, hoffnungsfrohe und zukunftsweisende Buchprojekt möglich wurde, waren ein paar Jahre der Planung nötig; außerdem mussten zig Tausend Euro finanziert werden – was letztlich nur durch ein professionelles Team und unbedingte Hingabe an die Sache funktionieren konnte.
Doch bevor dieses in seiner Art einmalige, hoffnungsfrohe und zukunftsweisende Buchprojekt möglich wurde, waren ein paar Jahre der Planung nötig; außerdem mussten zig Tausend Euro finanziert werden – was letztlich nur durch ein professionelles Team und unbedingte Hingabe an die Sache funktionieren konnte.
 Schluss mit dem Kampf gegen Windmühlen
Schluss mit dem Kampf gegen Windmühlen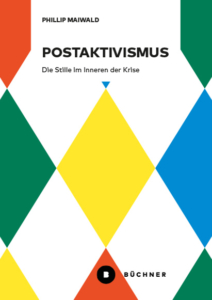 Phillip Maiwald
Phillip Maiwald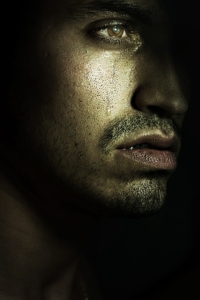 Vom Wert der Tränen
Vom Wert der Tränen Hüter/innen der Erde
Hüter/innen der Erde

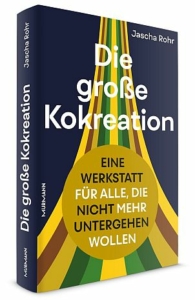 Kein Was ohne Wie
Kein Was ohne Wie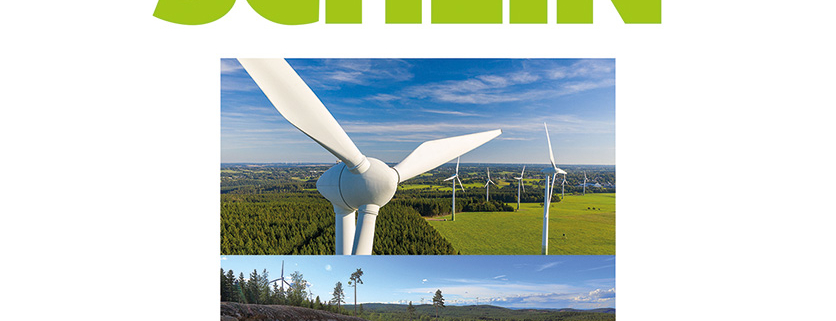
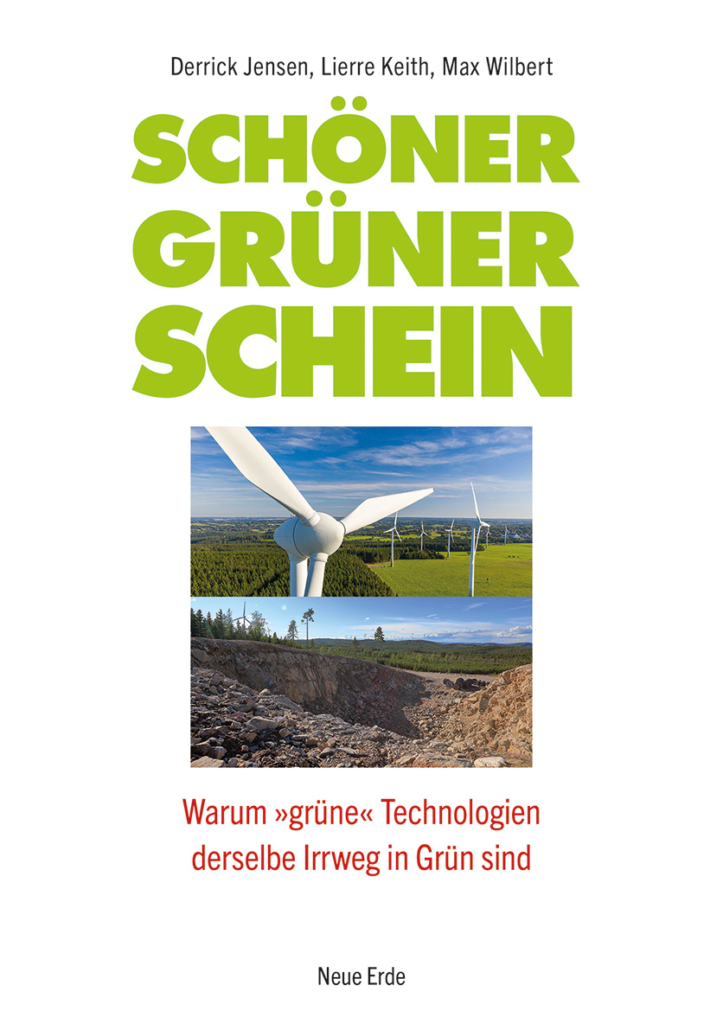

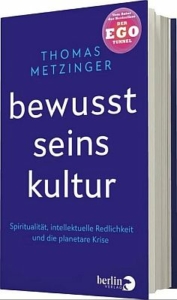 Wenn es da nicht einen ganz anderen, hoffnungsvollen Denkansatz gäbe. Der US-amerikanische Philosoph David R. Loy formuliert es in seinem Buch „ÖkoDharma“ so: „… die ökologische Krise [ist] mehr als ein technologisches, ökonomisches oder politisches Problem … Sie ist auch eine kollektive spirituelle Krise und ein möglicher Wendepunkt in unserer Geschichte.“ Harald Welzer spricht von erforderlichen „mentalen Infrastrukturen“ und vom „Weiterbauen am zivilisatorischen Projekt“, auf dass eines Tages nicht mehr „die, die Müll produzieren“ ein „höheres gesellschaftliches Ansehen [genießen] als die, die ihn wegräumen“.
Wenn es da nicht einen ganz anderen, hoffnungsvollen Denkansatz gäbe. Der US-amerikanische Philosoph David R. Loy formuliert es in seinem Buch „ÖkoDharma“ so: „… die ökologische Krise [ist] mehr als ein technologisches, ökonomisches oder politisches Problem … Sie ist auch eine kollektive spirituelle Krise und ein möglicher Wendepunkt in unserer Geschichte.“ Harald Welzer spricht von erforderlichen „mentalen Infrastrukturen“ und vom „Weiterbauen am zivilisatorischen Projekt“, auf dass eines Tages nicht mehr „die, die Müll produzieren“ ein „höheres gesellschaftliches Ansehen [genießen] als die, die ihn wegräumen“.

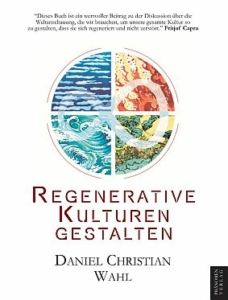 Daniel Christian Wahl (DCW) hat diese ungeheure Aufgabe mit seinem Buch in den Blick genommen. Nicht weil er wüsste, wie es geht, sondern weil er zumindest ganz gut weiß, wie es nicht geht: mit business as usual. So besteht seine Leistung letztlich aus einer gedanklichen Doppelarbeit: einerseits die ausgetretenen Pfade der Irrtümer und zuverlässigen Zerstörungen zu analysieren und andererseits Mittel und Methoden zu beschreiben, mit denen sich erstere vermeiden lassen. Die wichtigste Methode dabei lässt sich mit Rilkes berühmtem Satz zusammenfassen: „Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein.“ Es geht also nicht darum, die richtigen Antworten zu geben, sondern die richtigen Fragen zu stellen. Erst wenn es uns gelingt, die Richtung zu ändern, mit der wir uns in die Zukunft bewegen, können sich brauchbare Erfolge einstellen. Was geschieht, wenn wir das nicht tun, beschreibt ein chinesisches Sprichwort: „Wenn wir unsere Richtung nicht ändern, werden wir wahrscheinlich genau dort landen, wo wir gerade hingehen.“
Daniel Christian Wahl (DCW) hat diese ungeheure Aufgabe mit seinem Buch in den Blick genommen. Nicht weil er wüsste, wie es geht, sondern weil er zumindest ganz gut weiß, wie es nicht geht: mit business as usual. So besteht seine Leistung letztlich aus einer gedanklichen Doppelarbeit: einerseits die ausgetretenen Pfade der Irrtümer und zuverlässigen Zerstörungen zu analysieren und andererseits Mittel und Methoden zu beschreiben, mit denen sich erstere vermeiden lassen. Die wichtigste Methode dabei lässt sich mit Rilkes berühmtem Satz zusammenfassen: „Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein.“ Es geht also nicht darum, die richtigen Antworten zu geben, sondern die richtigen Fragen zu stellen. Erst wenn es uns gelingt, die Richtung zu ändern, mit der wir uns in die Zukunft bewegen, können sich brauchbare Erfolge einstellen. Was geschieht, wenn wir das nicht tun, beschreibt ein chinesisches Sprichwort: „Wenn wir unsere Richtung nicht ändern, werden wir wahrscheinlich genau dort landen, wo wir gerade hingehen.“
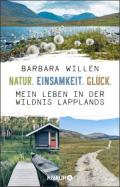 Es ist wohl kein Zufall, dass im Buchtitel das Wort „Einsamkeit“ von den beiden Wörtern „Natur“ und „Glück“ eingerahmt ist. Protagonistin dieser authentischen und sehr persönlichen, ja gelegentlich intimen Erzählung ist die Autorin selbst. Als Tochter eines Schweizer Berggängers und Bergfexes ist ihr der Aufenthalt in der freien Natur eine Selbstverständlichkeit; so gut wie jedes Wochenende verbrachte sie mit ihrer Familie in den Bergen. Lange Wanderungen, auch über Hunderte, ja Tausende von Kilometern bringen sie nicht zur Erschöpfung. Im Gegenteil: Fern des städtischen Getriebes, fern der Zivilisation sucht und findet sie immer wieder aufs Neue Glück im Herzen der Einsamkeit.
Es ist wohl kein Zufall, dass im Buchtitel das Wort „Einsamkeit“ von den beiden Wörtern „Natur“ und „Glück“ eingerahmt ist. Protagonistin dieser authentischen und sehr persönlichen, ja gelegentlich intimen Erzählung ist die Autorin selbst. Als Tochter eines Schweizer Berggängers und Bergfexes ist ihr der Aufenthalt in der freien Natur eine Selbstverständlichkeit; so gut wie jedes Wochenende verbrachte sie mit ihrer Familie in den Bergen. Lange Wanderungen, auch über Hunderte, ja Tausende von Kilometern bringen sie nicht zur Erschöpfung. Im Gegenteil: Fern des städtischen Getriebes, fern der Zivilisation sucht und findet sie immer wieder aufs Neue Glück im Herzen der Einsamkeit. 
