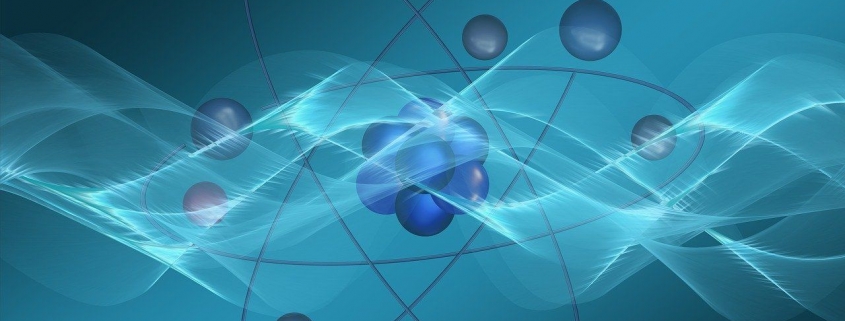Stell Dir vor, jeder Mensch lebt in Würde und unser wundervoller Planet atmet auf
von Dieter Höntsch
– es ist Frieden auf der Welt, die Menschen gehen wertschätzend miteinander um, egal welche Hautfarbe sie haben, egal welche Bildung sie haben,
– jeder Mensch hat, was er braucht zum Leben, keiner leidet mehr Not,
– die Tiere und Pflanzen gedeihen in all ihrer Vielfalt,
– die Landschaften und Meere sind sauber und entfalten ihre Faszination,
– das Klima ist im Gleichgewicht, keine in einem erdgeschichtlich unvorstellbaren Tempo schwindenden Gletscher, kein anwachsender Meeresspiegel,
– wir Menschen leben in einer lebenswerten und menschenwürdigen Welt, wir sind gesund dank gesunderhaltender Lebensweise, wir sind voller Leistungsfähigkeit, voller Lebensfreude und entfalten unsere Potenziale,
– wir haben die Möglichkeit, zum Gemeinwohl beizutragen, was uns erfüllt, ohne Druck,
– wir sind zufrieden und dankbar für alles, was uns an Wundervollem vergönnt ist,
– wir können uns glücklich fühlen, gemeinsam mit dem Partner, mit Kindern, Enkeln, Urenkeln und anderen Familienangehörigen, mit Freunden, mit Arbeitskollegen, mit Menschen, die uns sonst noch nah sind oder uns begegnen.
Alles nur ein Traum?
Nein, es ist möglich! Nicht gleich morgen, denn es ist schon ein großes Stück Weg, das wir gemeinsam gehen müssen. Es liegt an uns, wie lange wir für den Weg brauchen, wie lange es braucht, bis immer mehr von uns gelernt haben, umzudenken und eigenes Handeln zu verändern.
Nur Hirngespinnste, sagt der Pessimist
Die Mächtigen streben eher nach immer mehr Macht, als dass sie etwas davon abgeben, die meisten Wohlhabenden sind voller Gier nach mehr und klammern sich an ihren Reichtum. Und all die anderen müssen die Leere in ihrem Leben immer wieder füllen, indem sie konsumieren, um wenigstens Augenblicke des Glücks zu erleben, um nicht etwa weniger zu besitzen, als der Nachbar.
Ein realistischer und in naher Zukunft erreichbarer Traum, meine ich
Warum streben die Mächtigen nach immer mehr Macht, die Wohlhabenden nach immer mehr Reichtum und all die anderen nach mehr Konsum? Weil sie wie jeder Mensch Bedürfnisse haben, die sie sich erfüllen möchten. So lehrt es u.a. Marshall B. Rosenberg, der die Methode der Gewaltfreien Kommunikation entwickelt hat.
Menschen wollen unter anderem
– bedeutsam sein,
– Bestätigung erfahren,
– Erfolg haben,
– dazu gehören oder
– wertgeschätzt werden.
Ich habe diesen Text geschrieben, weil ich wirksam sein möchte, weil mir Frieden, Freiheit, Wahrheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit besonders wichtig sind. Texte zu schreiben, ist eine meiner Strategien, um mir Bedürfnisse zu erfüllen.
Leider haben die Strategien, mit denen sich Menschen Bedürfnisse erfüllen wollen nicht selten einen sehr hohen Preis – Menschenleben, menschliches Leid, Verlust an Lebensqualität, Verlust an Artenvielfalt und vieles mehr.
Lassen sich durch Erweiterung von Macht, Anhäufung von Reichtum oder dauerndem Konsum wirklich Bedürfnisse erfüllen? Was wir mit diesen Strategien erreichen können, das sind bestenfalls Momente des Glücks, Glückssternschnuppen vielleicht. Um Glücklichsein als andauerndes Lebensgefühl, die Sterne des Glücks, zu erfahren, braucht es andere Strategien.
Zum Glück gibt es Strategien, mit denen wir uns unsere Bedürfnisse nachhaltig erfüllen können. Sie kosten in der Regel kaum etwas und sind ausgesprochen erfolgversprechend. Meist sind diese Strategien ganz einfach. Ich bin zum Beispiel zu tiefst glücklich, wenn ich mich auf das Spiel meiner Enkel einlasse, einfach nur Zeit investiere. Dadurch erfüllen sich meine Bedürfnisse nach Freude, Liebe, Spiel, Unterstützung, Ausgelassenheit, Leichtigkeit und Spaß. Wir können natürlich auch Großes vollbringen, um uns Bedürfnisse zu erfüllen, beispielsweise die Not anderer Menschen lindern. Doch selbst das so selten gewordene „Danke!“ wieder in unseren Alltag zu integrieren, hilft uns, uns Bedürfnisse zu erfüllen, die nach Freundlichkeit und Wertschätzung im Miteinander zum Beispiel. Probieren Sie es aus, es tut wirklich gut.
Klingt zu einfach, um wahr zu sein? Übung macht dem Meister. Üben Sie sich darin, Strategien für die Erfüllung ihrer Bedürfnisse zu finden, die kaum etwas kosten, die Ihr Leben jedoch wahrhaft bereichern. Und praktizieren Sie das, was Sie finden immer öfter. Solches Verhalten in sein Alltagsleben zu integrieren, braucht allerdings doch etwas mehr, es braucht die Bereitschaft, immer wieder hinzuzulernen und die Beharrlichkeit, das Erlernte zu leben. Wer in solches Lernen und Handeln investiert, der erzielt eine wahrlich hohe Rendite, die eines erfüllten Lebens. Und er gesellt sich zu jenen, die sich auf den Weg in eine lebenswerte und menschenwürdige Zukunft begeben. Ich meine, Heinz Rudolf Kunze hat recht, wenn er singt:
„Die Zeit ist reif für ein riesiges Erwachen.“
Bild von Ulrike Leone auf Pixabay