In diesem dritten Teil geht es darum, dass wir lernen, innerhalb der planetaren Grenzen zu leben.
→ Teil 3 von Daniel Christian Wahl
→ Teil 1
→ Teil 2
In diesem dritten Teil geht es darum, dass wir lernen, innerhalb der planetaren Grenzen zu leben.
→ Teil 1
→ Teil 2
In diesem zweiten Teil der Reihe geht es um den sogenannten Earth Overshoot Day, den Tag im Jahr, an dem wir dem Ökosystem mehr entnommen haben, als dieses natürlicherweise regenerieren kann.
Krankheiten vermeiden? Besser Gesundheit kreieren. Umweltschäden reparieren? Besser ökologische Systeme schaffen, die sich selbst am Leben halten und regulieren können. Gesellschaftliche Brüche kitten? Besser aktiv Gemeinschaften organisieren, die die psychosoziale Gesundheit und das Wohlergehen einer möglichst großen Anzahl von Menschen dauerhaft gewährleisten. Unser politischer Diskurs ist zu sehr darauf fixiert, allgegenwärtige Verschlimmerungen aufzuhalten, abzumildern und im besten Fall rückgängig zu machen. So bleiben wir auf das Negative und dessen „Bekämpfung“ fixiert. Ins Positive gewendet, sollten ökologische und soziale Systeme mit einem hohen Grad an Resilienz geschaffen werden — weniger abhängig von andauernder menschlicher Korrektur, selbstreparierend, nachhaltig. Wie das funktionieren könnte, zeigt der Autor in seiner dreiteiligen Serie auf.
→ Teil 2 (geplant für 19.3.24)
→ Teil 3 (geplant für 21.3.24)
von Dipl.-Ing. agr. Ulrike B. Rapp
Es klingt wie die Erfüllung eines ewigen Gärtnertraums: immer größeres und besseres Gemüse ernten, ohne Mehraufwand an Arbeit und ohne Düngung. Auf einer Kompostanlage in Griechenland ist dieses Phänomen aufgetreten. Es wird seit 20 Jahren von Fachleuten untersucht und ist nun reif für die breite Anwendung in der Praxis.
Die Geschichte beginnt mit dem Material einiger Kompostmieten, das im Jahr 2003 nicht in Säcke verpackt und verschickt werden konnte. Der Betreiber der Anlage ist Dr. Johannes Eisenbach, ein deutscher Landwirt und qualifizierter Agrarökonom, der sich seit den 90-er Jahren in Kalamata dem Olivenanbau widmet. Um die Bodenfruchtbarkeit in den Olivenhainen zu erhalten, hatte er begonnen, die Verarbeitungsrückstände nach dem Pressen des Olivenöls zu kompostieren, um sie seinem Agrarökosystem zurückzugeben. Der Kompost auf den 2003 liegengebliebenen Hügeln wurde nun so reif, dass sich darauf durch Flugsamen verbreitete Pflänzchen ansiedeln konnten. „Dann bauen wir jetzt eben Gemüse darauf an“, war die Folgerung des passionierten Agrarökonomen und so entstanden in der Kompostanlage Hügelbeete aus reinem, reifem Kompost. Jeder Gärtner weiß: Organische Substanz reduziert im Kompostierungsprozess ihr Volumen, und auch später im Gartenbeet oder auf dem Acker baut sich der Kompost langsam wieder ab. Doch auf der Kompostierungsanlage in Kalamata kam es in den Folgejahren des Gemüsesanbaus zu einer erstaunlichen Entdeckung: Die Komposthügelbeete verringerten ihre Masse nicht mehr und das Gemüse gedieh immer prächtiger. Eine 3 Kilogramm schwere, riesige Rote Beete versetzte die erfahrene Köchin der Kantine des Unternehmens in völliges Erstaunen: Solch eine wunderbar zarte Konsistenz und solchen hervorragenden Geschmack hatte sie bei dieser Größe niemals erwartet. Bei der Untersuchung des Substrats der Hügelbeete mit Feldmethoden stellte Dr. Eisenbach sodann fest, dass auch die Textur des Bodenmaterials nicht mehr der des gewöhnlichen Komposts entsprach; stattdessen war es nun ein erdiges Substrat. Das war der Beginn einer bewegenden Reise zur wissenschaftlichen Erklärung dieser fast unglaublichen Entdeckung, einer neuartigen Form stabiler, organischer Substanz mit außergewöhnlicher Düngewirkung, die später den Namen „Biozyklische Humuserde“ erhielt.
Stabile, organische Substanz im Boden wird gewöhnlich als Dauerhumus bezeichnet. Dieser ist für die nachhaltige Fruchtbarkeit der Böden verantwortlich und entsteht normalerweise in Jahrtausenden vor allem in den Böden unter natürlichen Wäldern. Naturbelassene Wälder sind oft sehr artenreich und es erstaunt, dass all die verschiedenen Pflanzen, trotz ihrer unterschiedlichen Nährstoffansprüche auf demselben Boden gedeihen. Dies deutet auf eine in jüngster Zeit mehr und mehr in den Fokus wissenschaftlicher Studien rückende Beobachtung hin. Pflanzen nehmen nicht nur passiv die im Bodenwasser gelösten Nährstoffe auf (wie in einer Hydrokultur), sondern kommunizieren aktiv mit den Mikroorganismen in der unmittelbaren Nähe ihrer Wurzeln, der Rhizzosphäre. Sie bilden Symbiosen v.a. mit Bakterien und Pilzen, indem sie sie mit energiehaltigen Zuckerverbindungen „füttern“ und dafür von ihnen mit verschiedensten Formen auch hochmolekularer Nähstoffverbindungen versorgt werden. Über diese unglaublich komplexen Vorgänge zwischen Mikroorganismen und Pflanzen im Boden ist bisher noch wenig bekannt. Die Beobachtung aber, dass die Mikrobenkonzentration in der Rhizzosphäre (unmittelbare Umgebung der Wurzel) der Pflanzen im Vergleich zum umliegenden Boden um das 5- bis 50-fache erhöht ist, weist auf die enorme Bedeutung dieser Prozesse hin. Die Belebung des Bodens durch die Pflanzen – sozusagen im Kreislauf des Lebens, (oder Biozyklus, von bios (gr.) = Leben, und kyklos (gr.) = Kreislauf) – ist als der wesentliche Prozess für die Bodenbildung und damit dem Aufbau von Dauerhumus unter natürlichen Bedingungen anerkannt.
Anders als in natürlichen Ökosystemen mit ihren meist nährstoffarmen Böden, laufen nun diese prinzipiell gleichen Prozesse auf den nährstoffreichen Komposthügeln ab, die mit Gemüse bepflanzt werden. In reifem Kompost liegen die Nährstoffe jedoch in anderer Form vor als in einem gewöhnlichen Gemüsebeet oder einem Acker, der beispielsweise mit Mist gedüngt ist. In diesen „normalen“ Beeten und Äckern findet sich, eben aufgrund der damit verbundenen Düngepraxis, eine beträchtliche Menge der Nährstoffe frei verfügbar im Wasser des Bodens (Nährsalze in der Bodenlösung) gelöst und wird von den Pflanzen wie in der Hydrokultur durch Osmose aufgenommen. Im reifen Kompost hingegen sind die reichlich vorhandenen Nährstoffe fest in den organischen Strukturen gebunden. Eben dies veranlasst die Gemüsepflanzen, den oben beschriebenen Prozess, in der aktuellen Fachliteratur als „Kohlenstoffpumpe“ bezeichnet, einzusetzen. Die australische Wissenschaftlerin Christine Jones hat herausgefunden, dass die Pflanzen bis zu 50 % der von ihnen in der Photosynthese produzierten Zucker (= kurzkettige Kohlenstoffverbindungen) über ihre Feinwurzeln an den Boden abgeben. Diese „Energiepakete“ werden von Bakterien und Pilzen im Kompostbeet zerlegt, und die Pflanze kann im Gegenzug deren „Produkte“ aufnehmen und sich davon ernähren.
Als Nebenprodukt dieser Symbiose reichern sich im Boden im Verlauf der Zeit die „Reste der Energiepakete“ an, die von den Mikroorganismen nicht weiter verwertet werden können. Das sind niedermolekulare Kohlenstoffverbindungen, die man als „Krümel“ bezeichnen könnte. Da Kohlenstoff bekanntermaßen die Fähigkeit besitzt, sehr stabile, kristalline Strukturen (wie Diamant oder Graphit) zu bilden, kann nun aus diesen Reststücken eine besondere, amorphe oder vermutlich sogar vorkristalline Kohlenstoffstruktur entstehen. Diese sind es, die das erdähnliche Substrat, das Dr. Eisenbach nach einigen Jahren auf den bepflanzten ehemaligen Komposthügeln fand, zu biozyklischer Humuserde mit bisher unbekannten Eigenschaften macht.
Bemerkenswert ist, dass es sich hierbei um einen autodynamischen oder sich selbst verstärkenden Prozess handelt, denn diese amorphen oder vorkristallinen Strukturen im Boden bilden den idealen Lebensraum für die Mikroorganismen selbst. Sie zeichnen sich durch kleine Zwischenräume (Poren) aus, in denen sich die Feuchtigkeit hält, wie auch durch größere, in denen die Luft zirkulieren kann, d. h. der Boden kann „atmen“. Die Pflanzen pumpen also fortwährend Kohlenstoff in den Boden, leben in Symbiose mit ihren Mikrobengemeinschaften, und aus den Reststoffen formt sich immer neuer Lebensraum für diese. So erklärt sich nach bisherigem Forschungsstand ein kontinuierliches Wachstum des lokalen Bodenmikrobioms und damit die in der Praxis beobachteten stetig steigenden Ernteerträge, sowie die außergewöhnliche Qualität der Lebensmittel. Die eindrucksvollen Ertragssteigerungen konnten bisher schon in zwei Experimenten an den Universitäten Athen¹ und Berlin² wissenschaftlich bestätigt und im Rahmen von Masterarbeiten publiziert werden.

Biozyklische Humuserde
*ENTSTEHUNG: durch mehrjährige Bepflanzung der Hügel des vollreifen Komposts. (= PCS, siehe Erklärung im Textfeld unten) mit möglichst vielfältigen Mischkulturen, nach dem Vorbild der Natur. So entsteht aus PCS die biozyklische Humuserde in für die Veredelung biozyklischer Humuserde zertifizierten Gemüsebaubetrieben.
* EIGENSCHAFTEN:
– keine Auswaschung von Nährstoffen
-voll pflanzenverträglich in allen Entwicklungsstadien
– unerwartet hohe Ernten, von Jahr zu Jahr steigend, wenn die Kulturpflanzen auf reiner Humuserde ohne Bodenzusätze und unter Verzicht jeglichen wasserlöslichen Düngers angebaut werden
Diverse Untersuchungen deuten darauf hin, dass der Gehalt unserer Lebensmittel an lebenswichtigen Mineralien und Spurenelementen seit Jahrzehnten kontinuierlich sinkt. Neben anderen Faktoren kann dies den Anstieg verschiedenster in den letzten Jahren zunehmender Erkrankungen zumindest teilweise erklären. Die australische Bodenbiologin Dr. Christine Jones führt den Nährstoffverlust in Lebensmitteln auch auf den schlechten Zustand der Böden zurück, auf denen diese Lebensmittel produziert werden. Weltweit haben landwirtschaftliche Flächen durch den Einsatz von Agrarchemikalien bereits 30-70% des Kohlenstoffgehalts und damit einen beträchtlichen Anteil des Humusgehalts und des Bodenlebens verloren.
Es versteht sich von selbst, dass Lebensmittel, die auf biozyklischer Humuserde angebaut werden, von unvergleichlich besserer Qualität sind. Auf der von intensivsten Lebensprozessen so erfüllten, biozyklischen Erde wachsen biotisch einzigartige Nahrungsmittel von höchstem Wert für die menschliche Gesundheit.
Seit einigen Jahren arbeitet das Team um Dr. Eisenbach kontinuierlich daran, die Rahmenbedingungen für die weltweite Verfügbarkeit von Biozyklischer Humuserde zu schaffen. „Es war eine große Herausforderung, eine Organisation aufzubauen, die sowohl die Beschaffung der für die Steigerung der Produktion von PCS erforderlichen Mittel verwaltet als auch den Produktionsprozess in allen Schritten überwacht und dokumentiert“, erklärt Dr. Eisenbach. PCS (Phytoponic Compost Substrate, von phytho (gr.)= Pflanze, und ponos (gr.) =Arbeit, Mühe) ist vollreifer Kompost rein pflanzlicher Herkunft und nach bisherigen Erkenntnissen unabdingbar als Ausgangsmaterial für die Entstehung von Biozyklischer Humuserde.
Der anfängliche Kompostierungsprozess wird nach streng definierten Parametern gesteuert; es müssen unter anderem Temperatur, Feuchtigkeit und CO2 Gehalt ständig überwacht werden, damit der Kompost zum richtigen Zeitpunkt gewendet werden kann. Beim Wenden wird die Kompostmiete sozusagen belüftet, damit die Mikroorganismen nach dem Vorbild der Natur zu jedem Zeitpunkt genügend Sauerstoff für ihre Arbeit zur Verfügung haben. Ein solch komplexes Verfahren kann in der Regel am besten in professionellen Kompostierungsanlagen gewährleistet werden, in denen zusätzlich die Verbleibdauer des Kompostes bis zur Vollreife verlängert ist. Die erforderlichen, finanziellen Mittel dafür bereitzustellen, ist das Ziel der Bemühungen von Dr. Eisenbachs Team. Anschließend soll in zertifizierten gärtnerischen Betrieben die Bepflanzung mit Mischkulturen erfolgen, mittels derer dann der vollreife Kompost (PCS) in bis zu 5 Jahren zur Biozyklischen Humuserde „veredelt“ wird. Es könnte einen interessante Alternative für viele Betriebe sein, da ihnen das PCS unentgeltlich für die Dauer der Veredelung zur Verfügung gestellt wird. Das darauf geerntete Gemüse können sie selbständig vermarkten, wobei die Einhaltung der biozyklisch-veganen Richtlinien, genau wie bei anderen biologischen Anbauverbänden, jährlich kontrolliert wird. Wenn der Veredelungsprozess abgeschlossen ist, wird zusammen mit den an der Schaffung der finanziellen Grundlagen für die Entstehung der Biozyklischen Humuserde Beteiligten über die weitere Verwendung entschieden, Einzelheiten dazu sind im Terra-Plena-Fonds geregelt. Natürlich kann die veredelte Humuserde dann auch in landwirtschaftlichen Betrieben genutzt werden.
Phythoponisches Compost Substrate (PCS) ≈ vollreifer Kompost
*ENTSTEHUNG: aus überwachtem und gesteuertem Kompostierungsprozess aus rein pflanzlichen Ausgangsmaterialien auf einer Kompostanlage oder einem spezialisierten land- oder gartenbaulichen Betrieb entsteht reifer Kompost. Dieser wird weiter in der Miete gelagert bis er sich auf natürliche Weise begrünt und so zur Vollreife kommt.
*EIGENSCHAFTEN:
– es kann zur Auswaschung sehr geringer Nährstoffmengen kommen
– voll pflanzenverträglich, muss für Bepflanzung nicht mit Erde vermischt werden
– gute Erträge
Als finanzieller Mechanismus, der die weltweite Verbreitung Biozyklischer Humuserde ermöglichen soll, wurde der Terra-Plena-Fonds geschaffen. Investoren werden hier zu „Bodenkuratoren“, die mitwirken an der Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und damit der Sicherung der Welternährung. Eine Wertsteigerung der Fondsanteile ist zunächst mit der steigenden Nachfrage nach fruchtbarer Erde zu erwarten. Auch sollen in Zukunft CO2-Zertifikate auf die Entstehung Biozyklischer Humuserde ausgestellt werden. Es wurde errechnet, dass die Erzeugung von 2,5 Tonnen Biozyklischer Humuserde auf zertifizierten Veredelungsflächen etwa 1 Tonne CO2-Äquivalente bindet. Des Weiteren ist geplant, eine naturwertbasierte dezentrale „Fruchtbarkeitswährung“ terra libra bereitzustellen, die auf einem Blockchain-basierten Marktplatz verfügbar ist. Eine elektronische Währung, die sich durch einen stabilen, natürlichen Wert auszeichnet und mit der gesunde, schmackhafte und biologisch nährstoffreiche Lebensmittel angebaut und erworben werden können, ist eine absolut neuartige Möglichkeit der Zukunftssicherung.
Wir leben in Zeiten, in denen die menschliche Gesundheit besonders bedroht scheint und der Zusammenhang mit der belasteten Umwelt sowie der Zerstörung insbesondere der Bodenfruchtbarkeit nahezu allseitig anerkannt ist. Umso wichtiger wird es, natürliche, im Kreislauf des Lebens entstandene, fruchtbare Erde als universelle Existenzgrundlage zu erkennen, ihren Wert zu schätzen und zu fördern. Bleibt zu wünschen, dass die Entdeckung auf den Komposthügeln von Kalamata, im Zusammenwirken interessierter Personen und Organisationen möglichst schnell dazu beitragen kann, Gartenbau und Landwirtschaft zu einer lebensfördernden Praxis zu transformieren.
________________
¹Eisenbach L.D. et al. (2018): Effect of Biocyclic Humus Soil on Yield and Quality Parameters of Sweet Potato (Ipomoea batatas L.). Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LXI, No. 1, 2018. S.210-217
²Schubert, Anna: Masterarbeit an der Humboldt-Universität Berlin, März 2023, Stickstoffdüngewirkung veganer organischer Reststoffe durch einen Gefäßversuch mit Deutschem Weidelgras (Lolium perenne L.)
|
Den meisten jungen Deutschen dürfte es geläufig sein, eine Internetseite den eigenen Wünschen anzupassen. Das heißt dann zum Beispiel „Mein Yahoo“. Personalisieren, wie man das nennt, ist Trend. Warum dann nicht so weit gehen, auch seine Lebensgrundlagen zu „personalisieren“, also weg von der Massennahrung, hin zum Selbstgemachten?
Sauerkraut wäre da ein guter Einstieg. Weiterlesen
Bobby Langer: Jascha, dein kürzlich erschienenes Buch „Die große Kokreation“ bezeichnet sich als „Standardwerk für transformative Kokreation in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft“. Ist das ein Buch für Spezialisten bzw. Experten, also zum Beispiel Soziologen oder Politologen, oder schreibst du für eine breitere Zielgruppe?
 Jascha Rohr: Ich schreibe für alle, die sich engagieren, die Dinge bewegen und verändern wollen und wissen, dass das gemeinsam besser geht als alleine. Das ist, so hoffe ich, eine sehr breite Zielgruppe, die Expert:innen einschließt, sich darüber hinaus aber auch an Führungskräfte, Aktivist:innen, Unternehmer:innen, Projektleiter:innen, lokal Engagierte und viele mehr richtet, die den Anspruch haben, mit ihrer Arbeit einen positiven Beitrag zur Gestaltung der Welt zu leisten.
Jascha Rohr: Ich schreibe für alle, die sich engagieren, die Dinge bewegen und verändern wollen und wissen, dass das gemeinsam besser geht als alleine. Das ist, so hoffe ich, eine sehr breite Zielgruppe, die Expert:innen einschließt, sich darüber hinaus aber auch an Führungskräfte, Aktivist:innen, Unternehmer:innen, Projektleiter:innen, lokal Engagierte und viele mehr richtet, die den Anspruch haben, mit ihrer Arbeit einen positiven Beitrag zur Gestaltung der Welt zu leisten.
B.L.: Was verpasst man, wenn man es nicht gelesen hat?
J.R.: Das Buch ist voller Modelle, Methoden, Theorie und Praxis, so dass wir zu informiert Handelnden werden können. Ich persönlich sehe den wertvollsten Beitrag des Buches aber darin, dass es ein neues ökologisches Paradigma anbietet, mit dem wir die Prozesse von Entwicklung, Veränderung und Gestaltung viel besser verstehen und anwenden können.
B.L.: Du sagst, es gehe dir um die „Neuerfindung unserer planetaren Zivilisation“. Das klingt im ersten Moment ziemlich abgehoben. Weshalb hältst du diese Neuerfindung für notwendig?
J.R.: Das ist natürlich erst einmal eine Provokation. Und eine homogene globale Zivilisation gibt es in diesem Sinne auch gar nicht. Aber klar ist: Wenn wir global so weitermachen wie bisher, zerstören wir unsere Lebensgrundlagen und damit das, was wir Zivilisation nennen. Das kennen wir aus der Vergangenheit der Menschheit im Kleinen. Da konnte es dann aber immer an anderer Stelle weitergehen. Kollabieren wir heute als globale Zivilisation, gibt es keinen Ausweichplaneten. Diesmal muss es uns gelingen, uns neu zu erfinden, bevor wir komplett kollabieren. Das nenne ich Neuerfindung unserer Zivilisation.
B.L.: Wer bist du, um sagen zu können, du wärest zu einer solchen Konzeptleistung in der Lage?
J.R.: Mein Beruf ist es, seit ca. 25 Jahren kleine und große Gruppen darin beizustehen, sich selbst neu zu erfinden – vom Dorf bis zur nationalen Ebene habe ich Beteiligungs- und Gestaltungsprozesse konzipiert und begleitet. Meine Leistung dabei ist es, den Prozess zu strukturieren und zu halten, in dem diese Gruppen sich selbst erfinden. Ich bin so etwas wie eine Gestaltungshebamme. In diesem Sinne würde ich mir auch nicht anmaßen, alleine unsere Zivilisation neu zu erfinden. Aber ich fühle mich gut darauf vorbereitet, auch große internationale und globale Prozesse zu konzipieren, methodisch zu unterstützen und zu begleiten, in denen die Beteiligten miteinander beginnen, „Zivilisation“ neu zu erfinden.
B.L.: Gibt es nicht mehr als eine Zivilisation auf dem Planeten? Wenn du also von „planetarer Zivilisation“ sprichst, klingt das so, als würdest du die westliche, industriell geprägte Zivilisation mit der planetaren gleichsetzen?
J.R.: Ja genau, das klingt so, dessen bin ich mir bewusst, und das ist natürlich nicht so. Und doch gibt es so etwas wie eine globale diverse Gesellschaft, globale Märkte, eine globale politische Arena, eine globale Medienlandschaft, globale Diskurse, globale Konflikte und globale Prozesse, zum Beispiel in Bezug auf Corona oder den Klimawandel. Dieses sehr heterogene Feld nenne ich vereinfacht globale Zivilisation, um klarzumachen: Dieses globale Feld ist in seiner Ganzheit eher toxisch als heilsam. Es muss transformiert werden im Sinne einer globalen Regeneration.
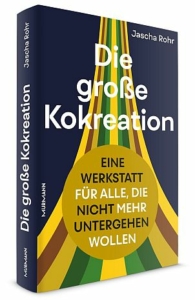 B.L.: Du schreibst ein ganzes Buch lang über Methoden und Werkzeuge. Hast du keine Sorge, dass deine Zielgruppe auf Inhalte pocht?
B.L.: Du schreibst ein ganzes Buch lang über Methoden und Werkzeuge. Hast du keine Sorge, dass deine Zielgruppe auf Inhalte pocht?
J.R.: Das ist die Krux. Es gab viele, die hätten sich lieber ein einfaches Rezeptbuch gewünscht: Lösungen zum Nachmachen. Und genau da wollte ich ehrlich bleiben: Aus dieser Rezeptlogik müssen wir aussteigen, sie ist Teil des Problems. Nachhaltige Lösungen haben immer damit zu tun, dass wir lokale Kontexte verstehen und dafür angepasste Lösungen entwickeln. Das habe ich aus der Permakultur gelernt. Dazu müssen wir uns trainieren und ausbilden. Dafür braucht es Methoden und Werkzeuge. Den Rest müssen die Kokreator:innen vor Ort leisten.
B.L.: Du schreibst: „Benutzen wir … die Werkzeuge der alten Zivilisation, kann nur eine neue Version der alten Zivilisation dabei herauskommen.“ Das ist logisch. Nur: Wie willst du als Kind der alten Zivilisation Werkzeuge einer neuen Zivilisation finden?
J.R.: Das geht nur über Transformationsprozesse. Und ich benutze diesen Begriff nicht leichtfertig, sondern in aller Konsequenz und Tiefe: Jede:r, der oder die mal einen Kulturschock erlebt hat und sich in eine neue Kultur einleben musste, der oder die eine religiöse Einstellung geändert hat, das berufliche Leben neu begonnen hat oder eine langfristige Beziehung für eine neue verlassen hat, kennt solche einschneidenden Veränderungsprozesse. Ich selbst habe meine ganz persönlichen Krisen und Auseinandersetzungen gehabt, in denen ich immer wieder zumindest Aspekte der „alten Zivilisation“ persönlich transformieren konnte. Meine Gründungen der Permakultur Akademie, des Instituts für partizipatives Gestalten und der Cocreation Foundation waren jeweils von genau solchen Erkenntnisprozessen getragen, die dann ihren gestalterischen Ausdruck in diesen Organisationen gefunden haben. Aber natürlich bin auch ich noch verhaftet, ich verstehe mich als Mensch in Transition.
B.L.: Obwohl du deine Augen nicht vor der Lage der Menschheit verschließt („Der Einsatz ist hoch, die Welle gefährlich, möglicherweise tödlich“), ist der Grundtenor deines Buches ausgesprochen positiv. Woher nimmst du deinen Optimismus?
J.R.: Der Optimismus ist eine Überlebensstrategie. Ohne ihn hätte ich gar nicht die Kraft, das zu tun, was ich tue. Woher sollen wir die Energie für so viel Wandel und Gestaltung nehmen? Ich glaube, dass wir das nur schaffen, wenn wir aus dieser Aufgabe Kraft, Freude, Lebendigkeit und Fülle für uns schöpfen. Ich mache das mit Hoffnung spendenden Narrativen. Wenn ich mich damit selbst manipuliere, nehme ich das gerne in Kauf: Lieber eine positive selbsterfüllende Prophezeiung als eine negative!
B.L.: Das Buch war der Band 1. Was können wir von Band 2 erwarten?
J.R.: In Band 1 haben wir den Werkzeugkoffer gepackt und uns den Kollaps und die Vision angeschaut. In Band 2 gehen wir in die Transformation, in die Höhle des Monsters sozusagen. Die drei bestimmenden Themen werden sein: Resonanz, Trauma und Krise. Heftiger Stoff, aber auch unglaublich spannend! Ich forsche gerade sehr stark dazu, was es in Gruppen heißen kann, das kollektive Nervensystem zu beruhigen, zu regulieren und Traumata zu integrieren. Ich glaube – eine weitere grobe Metapher –, dass unsere globale Zivilisation sich am besten mit einer Suchtanalogie beschreiben lässt: Wir sind süchtig nach Energie und Konsum. Eine nachhaltige Regeneration wird uns nur gelingen, wenn wir von der Nadel kommen. Das ist keine einfach zu lösende Sachthematik, sondern ein kollektivpsychologisches Problem. Aber meine Arbeitsweise ist ja generativ, ich bin selbst gespannt, was im weiteren Schreibprozess passiert.
Jascha Rohr, Die große Kokreation. Eine Werkstatt für alle, die nicht mehr untergehen wollen. 400 S., 39 Euro, Murmann Verlag, ISBN 978-3-86774-756-1
„Wie können wir es schaffen, mit zehn bis zwölf Milliarden Menschen gut auf dieser Erde zu leben? Wie erreichen wir für alle ein Leben in angemessenem Wohlstand, in Frieden und Freiheit und in einem global intakten und vielfältigen Ökosystem?“ Jascha Rohr
Von Bobby Langer
Könnte man den geläufigen Ausdruck „das Buch der Stunde“ auf eine ganze Epoche übertragen, dann träfe er auf dieses Buch zu. Es erhitzt sich nicht an – immer diskutablen – Inhalten, sondern beschäftigt sich klug, systematisch und auf viel Erfahrung zurückgreifend mit den uns bleibenden Möglichkeiten, das Ruder herumzureißen.
Der Autor Jascha Rohr beschreibt sein Buch folgendermaßen: „Wir haben einen kokreative Werkstatt in Form eines Buches vor uns, die aus einer Reihe von Werkräumen besteht, den Kapiteln dieses Buches. Unser Ziel ist der Entwurf für die große Kokreation.“
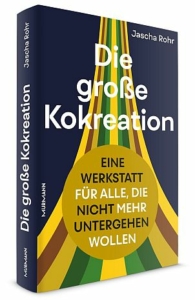 Kein Was ohne Wie
Kein Was ohne WieFür viele Laien, aber auch Experten in Sachen Nachhaltigkeit, Erderwärmung oder Artensterben sieht es eher hoffnungslos aus. Gleich dem vom Auge der Schlange gebannten Kaninchen stehen sie dem lebensverschlingenden Verhalten der industriellen Zivilisation ratlos gegenüber. Jascha Rohr hat – wenigstens für sich – diesen Bann gebrochen. Statt sich dystopischen Gedanken zu überlassen, überlegt er, wie eine nachhaltige Umgestaltung der Welt funktionieren könnte. Denn, so findet er, ohne über das Wie nachgedacht zu haben, brauchen wir uns über das Was erst gar keine Gedanken zu machen. „Die große Kokreation“ ist für ihn ein „Entwurf darüber, wie wir unsere globalen Probleme besser miteinander lösen können“. Die Zukünftigen lässt er rufen: „Stellt euch den Herausforderungen und Schwierigkeiten, entwickelt positive Wirkung. Baut auf das, was euch Kraft gibt und im besten Sinne wirkmächtig macht – auf eure Lebendigkeit, Kreativität, Freude und Liebe, eure Lust, Begeisterung, Intelligenz und Empathie.“
Rohrs Buch ist eine „Werkstatt für alle, die nicht mehr untergehen wollen“ – so der Untertitel. Das kann nicht anders als komplex und auf hohem theoretischen Niveau angegangen werden. Und doch gelingt es dem Autor, sich dem großen Thema klar, übersichtlich und auch sehr persönlich und menschlich zu nähern. Mit anderen Worten: Man muss nicht Sozialwissenschaften studiert haben, um es lesen zu können. Dazu trägt bei, dass Jascha Rohr sowohl induktiv wie deduktiv arbeitet; d. h. manchmal begibt er sich von einem praktischen Beispiel ausgehend auf die Metaebene, manchmal startet er gedanklich auf der Metaebene und belegt seine Gedanken durch ein Beispiel. Selbst die Grafiken sind dank ihrer Skizzenhaftigkeit besser nachvollziehbar und einprägsamer, als dies „perfekte“, theoriebezogene Grafiken normalerweise sind. Und noch eines macht sein Buch lesenswert: Es ist getragen von dem unbedingten Willen, Positives in die Welt zu bringen – ohne die Augen vor den drängenden Problemen zu verschließen.
Entscheidend für Jascha Rohr: Es geht nicht um fertige inhaltliche Lösungen, sondern um die „Beschreibung des Wie …, also eines Prozesses. Dieser Prozess hat im Grunde längst schon begonnen … Es ist ein Prozess, in dem wir miteinander lernen, unsere Probleme ganz anders zu lösen, als wir es bisher versuchen … Das Ziel ist nichts Geringeres als die Neuerfindung unserer planetaren Zivilisation.“ Ein hoher Anspruch.
Die zentrale Methode für dieses „Global Resonance Project“ nennt er „Resonanzarbeit“. Und das ähnelt keiner bekannten Methode, ganz im Gegenteil: „Resonanzarbeit folgt keiner festen Strategie, sondern ist mäandernd, verknüpfend, assoziativ. Sie stellt vielfältige Verbindungen und Beziehungen her, um Kreativität, Ideen und Innovationen anzuregen. Im Idealfall entsteht daraus am Ende ein kokreativer Entwurf.“ Der Prozess ist „entwurfsorientiert. Er ist ein Angebot zum Selbstdenken, zum Entwickeln und Mitgestalten … [Das Buch] bietet die Möglichkeit der Auseinandersetzung in einem Feld – in diesem Fall ist das die planetare Zivilisation –, damit dann aus dem eigenen Impuls heraus und mit den eigenen Potenzialen und Möglichkeiten transformatorische Projekte entwickelt und in die Umsetzung gebracht werden können, sodass am Ende eine reale Veränderung in der Welt entsteht“.
Jascha Rohr geht es um zwei Fragen:
„Wie kann es sein, dass wir als Spezies unsere eigenen Lebensgrundlagen zerstören?“
Und: „Was kann Kokreation dazu beitragen, dass sich diese Dynamik zum Positiven wendet?“
Der Leser kann, wenn er möchte, mitverfolgen und dabei erlernen, wie sich Methoden in kokreativen Prozessen kontextspezifisch aus dem Prozess entwickeln und ist eingeladen, „in der eigenen Praxis mit diesen Ansätzen zu experimentieren“. Personen, die an eigenen Prozessen und Projekten arbeiten, empfiehlt Jascha Rohr, das Buch mit dem eigenen Projektteam zu lesen.
Klar: „Benutzen wir … die Werkzeuge der alten Zivilisation, kann nur eine neue Version der alten Zivilisation dabei herauskommen.“ Um diesem Fehler nicht zu erliegen, kommt die Kokreation ins Spiel, ein Wort, das der „Kooperation“ oder „Kollaboration“ ähnelt, sich aber deutlich davon unterscheidet. So bezieht sich das „Ko“ in Kokreation nicht nur auf Mitmenschen, sondern auf die gesamte Mitwelt, also auf alle Mitgeschöpfe, auch: Mitdinge. Es geht darum, Mittel und Wege zu finden, „mit der gesamten Welt gemeinsam zu gestalten, statt die gesamte Welt als Menschen zu gestalten“. Das klingt in der Tat nicht mehr nach einem „Werkzeug der alten Zivilisation“. Der Wortteil „kreation“ in Kokreation bezieht sich auf Kreativität als Grundlage von Emergenz in Kunst und Kultur, wozu unbedingt auch Architektur, Philosophie, Ingenieurskunst und Wissenschaft gehören. Anders als in der alten Zivilisation lässt sich in einem kokreativen Entwurfsprozess „meist gar kein klares Ergebnis definieren, sondern eher einen Ergebnistyp“. Auf der Suche nach neuen Lösungsansätzen werden „die Themen, Akteure und Kontexte aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und zueinander in Beziehung gesetzt“.
Der Vater aller Probleme ist der Subjekt-Objekt-Dualismus, den Jascha Rohr als „ontologisches Grundproblem der ökologischen Krise“ identifiziert. Um sich von ihm zu lösen, sind die entscheidenden begrifflichen Werkzeuge:
Das Feld: „die räumliche Konstellation von miteinander interagierenden Partizipateuren und ihre Wirkungen aufeinander“ (auch: „die Wirkungen und Kräfte, die sich zwischen den Elementen aufspannen“). Anders als „Systeme“ sind Felder nicht durchschaubar und nicht steuerbar.
Der Prozess: „die sich zeitlich entfaltende Dynamik eines Feldes“, bestehend „aus allen diesen Prozess prägenden Partizipateuren, deren Wirkungen und Interaktionen sowie der fortschreitenden generativen Entwicklung, die daraus resultiert“. Besonders wichtig und auch schon in kleinem Rahmen anwendbar und aufs Größere übertragbar: „Prozesse sind fraktal und verschachtelt.“ Zur Erklärung des damit Gemeinten: „Unser Leben ist ein Prozess, aber unsere Ausbildung, Beziehungsphasen und die Phasen, in denen wir einer bestimmten Profession nachgehen, sind ebenfalls Prozesse.“
Indem Rohr die Begriffe „Subjekt“ und „Objekt“ abschafft und durch „Partizipateur“ ersetzt, schafft er die gedankliche Voraussetzung für einen tatsächlich ontologischen Paradigmenwechsel: „Alle Dinge der Welt sind Dinge der Welt, weil sie an der Welt teilhaben.“ Folgerichtig können auch „eine Geschichte, eine Kaffeetasse, eine Blume und die Gravitation“ Partizipateure sein: „Alles in der Welt ist Partizipateur, wenn es wirkt und teilhat. Was nicht wirkt und an nichts teilhat, existiert nicht.“
Zusammenfassend: „Ein Feld ist ein Prozess zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ein Prozess ist ein Feld in seiner dynamischen Entfaltung.“ Die große Aufgabe, die Zukunft zu gestalten, kann folglich kein „funktionales Gestalten“ sein – das wäre das Übliche –, sondern „ein generatives, wechselseitiges, fluides Interagieren mit den Prozessen, die uns gestalten, während wir gestalten“. Erst wenn wir „die Dinge in ihrer jeweiligen intrinsischen Eigenart als Gegenüber anerkennen“, wird tatsächlich ein Ausweg aus dem Subjekt-Objekt-Dualismus vorstellbar hin zu einer ökologischen, kokreativen Demokratie.
Die dazu fähige und dafür notwendige Kulturtechnik ist die Kokreation. „Sie ist das Wie: Wie gestalten wir gemeinsam. Das Was ergibt sich dann daraus … das wird synchron passieren: Wir werden diese erst in den Anfängen sichtbare Kulturtechnik entdecken, entwickeln, erfinden, erlernen und trainieren müssen, während wir beginnen, sie anzuwenden und erste Ergebnisse zu produzieren.“
Und das ist dabei die Herausforderung: „Da rollt die phantastischste Wahnsinnswelle auf uns zu, die wir je haben reiten können. Der Einsatz ist hoch, die Welle gefährlich, möglicherweise tödlich, aber der Ritt, den wir nehmen könnten, kann der beste unseres Lebens werden.“ Sich dem zu stellen, ist eine gewaltige und riskante Aufgabe mit ungewissem Ausgang. Das schätzt auch Jascha Rohr so ein und gesteht: „Dieses Buch ist ein Wagnis und der Versuch, eine visionäre Geschichte zu erzählen.“ Ihm zuzuhören, ist fesselnd und lädt ein, dabei zu sein beim „planetaren Fest der Gestaltung“.
Jascha Rohr, Die große Kokreation. Eine Werkstatt für alle, die nicht mehr untergehen wollen. 400 S., 39 Euro, Murmann Verlag, ISBN 978-3-86774-756-1
„Was auch immer Sie lieben, es ist bedroht. Aber lieben ist ein Tätigkeitswort. Möge diese Liebe uns ins Handeln bringen.“
Es gibt so etwas wie das „fröhliche gute Gewissen der Grünen“. Gemeint sind damit nicht nur die Parteimitglieder, sondern alle, die auf diesem Segelschiff der Illusionen mitschwimmen. Im Schiffsbauch befindet sich die Vorstellung eines Green New Deal, mit dem wir die westliche Industriegesellschaft ohne sonderliche Abstriche retten und weiterbetreiben können.
Die Autoren von „Schöner grüner Schein“, Derrick Jensen, Lierre Keith und Max Wilbert, bezeichnen die Segelmeister und Passagiere dieses Segelschiffs als die „Hellgrünen“. Mit ihrem jüngst auf Deutsch erschienenen Buch tun sie alles, um Bewegung in die Wogen zu bringen und dieses ruhige Gewissen aufzuscheuchen. Kapitel für Kapitel belegen sie, dass eine „grüne“ Industriegesellschaft nur um den Preis weiterer und unaufhaltsamer Umweltzerstörungen möglich ist. „Hellgrüne Lösungen sind nur dazu da, den lebenden Planeten wieder und immer weiter zu zerstören.“
So sei also an den Anfang dieser Besprechung einerseits eine Warnung gestellt, andererseits ein Versprechen. Eine Warnung, weil die Lektüre der 463 Textseiten einem die „grüne Unschuld“ nimmt und der „deflorierte Leser“ danach ernüchtert seine Positionen überdenken muss; ein Versprechen hingegen für all jene, die schon immer das „Weiter so“ unter grüner Flagge mit Bauchgrimmen wahrgenommen haben. Hier bekommen sie endlich das inhaltliche, argumentative Rüstzeug für die nächste Debatte. Denn wenn in diesem Buch etwas nicht fehlt, dann sind das die Fakten: Fakten zur Solar- und Windindustrie, Fakten zur grünen Energiespeicherung, Fakten zu Recycling und Effizienz, zur grünen Stadt, zum grünen Netz und zur Wasserkraft sowie diversen Scheinlösungen wie Geothermie oder Kohlenstoffabscheidung.
Sowohl der lebende Planet als auch die nichtmenschlichen Lebewesen haben das Recht zu existieren. Das menschliche Wohlergehen hängt von einer gesunden Ökologie ab. Um den Planeten zu retten, müssen die Menschen innerhalb der Grenzen der natürlichen Welt leben.
Der Mensch ist von der Natur abhängig, und die Technologie wird die Umweltprobleme wahrscheinlich nicht lösen, aber politisches Engagement ist entweder unmöglich oder unnötig. Das Beste, was wir tun können, ist, uns in Eigenverantwortung zu üben … Der Rückzug wird die Welt verändern.
Es gibt ernsthafte Umweltprobleme, aber grüne Technologie und grünes Design sowie ethisches Konsumverhalten werden es möglich machen, den modernen, energieintensiven Lebensstil auf unbestimmte Zeit fortzusetzen.
Es gibt zwar ökologische Probleme, aber die meisten davon sind nicht so schlimm und können durch ein angemessenes Management gelöst werden.
—————————-
Alles, worum Derrick Jensen bittet, ist „ehrlich mit uns selbst zu sein“. Was er damit meint, zeigt er am Beispiel einer „unschuldigen“ Brille: „Sie besteht aus Plastik, für das Öl und Transportinfrastrukturen benötigt werden, und aus Metall, für das Bergbau, Öl und Transportinfrastrukturen erforderlich sind … und die moderne Glasherstellung erfordert Energie und Transportinfrastruktur. Die Minen, aus denen die Materialien für meine Lesebrille kommen, müssen irgendwo liegen, und die Energie für die Herstellung muss auch irgendwoher kommen.“ Es gibt nun mal kein Abrakadabra-Simsalabim für irgendein Industrieprodukt, auch wenn es uns so vorgespiegelt wird. Wir meinen, wir bräuchten nur das nötige Kleingeld zu haben, und schon „zaubern“ wir uns, ohne Umweltkosten, unseren Komfort herbei – eine kindliche Vorstellung.
Ein kleiner Wermutstropfen angesichts der vielen Fakten ist ihr relatives Alter. Der US-Titel „Bright Green Lies: How the Environmental Movement Lost Its Way and What We Can Do About It” erschien 2021. Die im Buch genannten Zahlen sind also wenigstens fünf Jahre alt. Andersherum wissen wir: So gut wie nichts hat sich seither zum Besseren gewendet.
Wie gut, dass das Autorenteam einen nicht im Regen stehen lässt. Auf rund 40 Seiten befasst es sich mit „wirklichen Lösungen“, an denen – zumindest dieser Logik nach – kein Weg vorbeigeht. Letzten Endes gehe es um alles oder nichts. Zu einer zukunftsfähigen Lösung, so die Autoren, werden wir erst kommen, wenn wir bereit sind, „eine Lawine von Wehmut auszuhalten … Aber wenn man diesen Planeten liebt, muss man es tun“. Was anstehe, sei eine Reindigenisierung der westlichen Lebensweise. „Wir müssen erkennen, dass, da die Erde die Quelle allen Lebens ist, die Gesundheit der Erde bei unseren Entscheidungsprozessen an erster Stelle stehen muss … Wenn wir unsere Werte ändern, werden bisher unlösbare Probleme lösbar.“ Wir müssen aufhören, uns die falschen Fragen zu stellen. „‚Wie können wir weiterhin industrielle Energiemengen gewinnen, ohne Schaden anzurichten?‘, ist die falsche Frage. Die richtige Frage lautet: ‚Was können wir tun, um der Erde zu helfen, die durch diese Kultur verursachten Schäden zu reparieren?‘“
Zurück zum Einstieg: Dieses Buch ist schwer verdauliche Kost, nicht weil es schwer zu lesen wäre, sondern weil es seinen Leserinnen und Lesern von Kapitel zu Kapitel mehr den Staub der Illusionen aus dem Zivilisationsmäntelchen klopft. „Schöner grüner Schein“, schreibt Vandana Shiva, sei „ein dringend notwendiger Weckruf, wenn wir verhindern wollen, dass wir schlafwandelnd aussterben – und damit den 200 unserer Mitgeschöpfe und Verwandten folgen, die täglich von einer extravistischen, kolonisierenden Geldmaschine in den Tod getrieben werden, die von grenzenloser Gier geschmiert und vom mechanistischen Geist des Industrialismus geleitet wird.“
Schöner grüner Schein. Warum »grüne« Technologien derselbe Irrweg in Grün sind. Von Derrick Jensen, Lierre Keith und Max Wilbert, Verlag Neue Erde, 517 S., 36 Euro, ISBN 978-3-89060-838-9
Von Angela Brüning
„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“
Diesem Martin Luther (fälschlicherweise) zugeschriebenen Zitat ist Hans-Joachim Bannier wahrlich nachgekommen; in seinem Sortengarten in Bielefeld wachsen ca. 350 bis 400 überwiegend alte Apfelsorten. In seinem Online-Vortrag am 16. Februar 2023 „Ökologische Apfelzüchtung und Neue Gentechnik / CRISPR/Cas9“ stellte er abermals sehr klar und überzeugend dar, warum moderne auf ein oder wenige Resistenz-Gene reduzierte Pflanzenzüchtungen und insbesondere die aktuell oft angepriesene Gentechnik in eine Sackgasse führen. Bannier wies nach, dass die seit den 1940er Jahren entwickelten Sorten, die heutzutage in deutschen Läden angeboten werden, letztlich auf Inzucht innerhalb von 5 besonders krankheitsanfälligen Apfelsorten beruhen und überhaupt nur unter starkem Einsatz von Pestiziden und ähnlichen Behandlungsformen ertragreich und großflächig angebaut werden können. Wie im Vortrag verdeutlicht, kann die Abweichung vom traditionellen Züchtungsmuster (dem Kreuzen einer schmackhaften mit einer robusten Sorte) in Verbindung gebracht werden mit der parallelen Entwicklung von Pestiziden und Fungiziden, insbesondere in Leverkusen.
In überzeugender Weise wurde durch den Vortrag offensichtlich, dass Diversität – in diesem Fall eine große Vielfalt verschiedener Apfelsorten – essentiell ist, um langfristig eine möglichst gute Nahrungsversorgung der Bevölkerung erreichen zu können.
Natürliche Diversität und dadurch auch Anpassungsfähigkeit sollten nicht nur bezogen auf Pflanzen, sondern weit darüber hinaus erneut zentral werden in unserem Umgang mit unserer Mitwelt – und auch mit unseren Mitmenschen. Wir können die Komplexität und das Zusammenspiel diverser Faktoren im Gefüge — beispielsweise von Pflanzen, Tieren, dem Boden, Wetterkonditionen, und vielem mehr — nicht einmal ansatzweise erfassen und verstehen. Gerade vor diesem Hintergrund täte etwas mehr Demut vor der mehr-als-menschlichen Welt unserer westlichen Gesellschaft gut. Statt Gott spielen zu wollen, sollten wir uns rückbesinnen auf unsere Vorfahren und Völker, heutzutage vor allem indigene Gruppen, die mit der Natur statt explizit gegen sie lebten und leben.
Aktuelle Trends in der Gentechnik und Apfelzüchtungen mit einem isolierten resistenten Gen folgen dem mechanistischen Weltbild, das auf Konfrontation, Konkurrenz und Ausbeutung beruht sowie anthropozentrisch ist, den Menschen also außerhalb des Naturkreislaufs sieht und die Menschheit über die Natur stellt. Wie Bannier im Vortrag berichtete, basiert beispielsweise gerade die gegenwärtige Rechtfertigung von Methoden wie der Genschere CRISPR/Cas9 auf (wirtschaftlicher) Konkurrenz und Kampf gegen Abläufe der Natur. Die Prämisse in dieser Logik ist, durch regelmäßige „Neuzüchtungen“ mit Hilfe von Gentechnik der Natur und immer wieder auch gegen Krankheiten resistent werdenden Pflanzen immer gerade einen Schritt voraus zu sein.
In den 1950er Jahren begann man in Deutschland, krankheitsanfällige Apfelsorten anzubauen, die (nur) mithilfe eines intensiven Einsatzes chemischer Spritzmittel gedeihen, mit denen man auf diesem Wege jedoch höchste Erträge erzielen konnte. Die daraus resultierenden Probleme im Apfelanbau versuchte man in den letzten Jahrzehnten dann züchterisch dadurch zu lösen, dass man die anfälligen Sorten mit einem japanischen Holzapfel kreuzte – in der Hoffnung, dass das dort entdeckte Resistenz-Gen gegen die Apfelschorf-Krankheit die Probleme lösen könne – und will dasselbe künftig mithilfe der neuen Gentechniken (CRISPR/Cas) erreichen. Weil einzelne Resistenz-Gene jedoch aus chemie-abhängigen Apfelsorten keine natur-gesunden Apfelsorten machen (und die Natur solche „mono-genetischen“ Resistenzen schnell überwindet), wollen Züchter heute die Probleme durch immer mehr gen-technische Eingriffe in den Griff bekommen.
Alle diese Strategien folgen einem von ökologischen Zusammenhängen entfremdeten mechanistischen Weltbild, das anthropozentrisch ist, den Menschen also außerhalb des Naturkreislaufs sieht und die Menschheit über die Natur stellt.
Die gleiche „Logik“ kennzeichnet unser heutiges Geld- und Wirtschaftssystem und in ähnlicher Weise sehr oft auch gesellschaftliche Entwicklungen im Umgang mit Randgruppen und sozialen Problemen. Statt den Kampf gegen einander und gegen unsere Mitwelt fortzusetzen und unser eigenes Überleben dadurch letztlich aufs Spiel zu setzen, wären wir gut beraten, die mehr-als-menschliche Welt wieder als Partner wertzuschätzen und im Sinn des systemischen Weltbilds Kooperation und Balance als Basis unseres Handelns zu nehmen.
Wer sich diesem Ansatz nähern und/oder ihn vertiefen möchte, ist herzlich eingeladen, an tiefenökologischen oder interkulturellen Seminaren bei Paths of Change teilzunehmen. Dort erproben wir gemeinsam, neue Wege zu gehen und gemeinsam einen Beitrag zu leisten für eine enkeltaugliche Zukunft. Im Vordergrund stehen dabei Methoden der Naturverbindung, die auch zu einer Selbstermächtigung beitragen: https://pathsofchange.net
Über eine Unterstützung zur Förderung der Diversität von Äpfeln und Birnen freut sich Apfelgut e. V. Die Spende kann direkt an den neu entstehenden Birnensortengarten des Arboretum Bielefeld weitergeleitet werden, wenn das Stichwort Birnenzucht angegeben wird.
Kontoinhaber: apfel:gut e.V.
IBAN: DE12 4306 0967 2078 0737 00
BIC: GENODEM1GLS (GLS Bank Bochum)
Stichwort: Birnenzucht
[Dieser Artikel ist unter einer Creative-Commons-Lizenz (Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 3.0 Deutschland) lizenziert. Unter Einhaltung der Lizenzbedingungen darf er verbreitet und vervielfältigt werden.]
Je selbstsüchtiger einer ist, desto mehr verliert er sein wahres Selbst. Je selbstloser einer handelt, desto mehr ist er er selbst. Michael Ende
Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Ein neues Paradigma steht an, ein Ontologiewechsel. Die Notwendigkeit einer sozial-ökologischen Transformation hat sich schon bis in Regierungskreise herumgesprochen. Doch zwischen Wunsch und Wirklichkeit klafft eine ganze Milchstraße von Schwierigkeiten: zum Beispiel die komplette Europäische Union und die Einzelinteressen jedes ihrer Mitglieder. Oder das Überlebensinteresse jedes kapitalistisch strukturierten Unternehmens weltweit. Und ganz zuletzt, aber wenigstens ebenso wichtig: das scheinbare Recht auf wohlständige Sattheit aller TeilnehmerInnen der Konsumgesellschaften auf der Erde. Ihnen allen ist gemeinsam: Mehr Bescheidenheit gliche einem kollektiven Versagen.
Ivan Illich hat das Problem so zusammengefasst: „Wenn Verhalten, das zum Wahnsinn führt, in einer Gesellschaft als normal gilt, lernen die Menschen, um das Recht zu kämpfen, sich daran zu beteiligen.“
Mit nur einem Hauch von Realismus könnte man also die Flinte ins Korn werfen, denn jeder Schuss wäre bei einem solchen Berg an Widrigkeiten sein Pulver nicht wert. Und im Vergleich zu der Annahme, in Establishment-Kreisen fasste jemand das Ziel einer sozial-ökologischen Transformation mit dem angemessenen Ernst ins Auge, wirken die Allmachtsphantasien eines Pubertierenden geradezu realistisch.
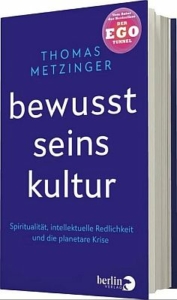 Wenn es da nicht einen ganz anderen, hoffnungsvollen Denkansatz gäbe. Der US-amerikanische Philosoph David R. Loy formuliert es in seinem Buch „ÖkoDharma“ so: „… die ökologische Krise [ist] mehr als ein technologisches, ökonomisches oder politisches Problem … Sie ist auch eine kollektive spirituelle Krise und ein möglicher Wendepunkt in unserer Geschichte.“ Harald Welzer spricht von erforderlichen „mentalen Infrastrukturen“ und vom „Weiterbauen am zivilisatorischen Projekt“, auf dass eines Tages nicht mehr „die, die Müll produzieren“ ein „höheres gesellschaftliches Ansehen [genießen] als die, die ihn wegräumen“.
Wenn es da nicht einen ganz anderen, hoffnungsvollen Denkansatz gäbe. Der US-amerikanische Philosoph David R. Loy formuliert es in seinem Buch „ÖkoDharma“ so: „… die ökologische Krise [ist] mehr als ein technologisches, ökonomisches oder politisches Problem … Sie ist auch eine kollektive spirituelle Krise und ein möglicher Wendepunkt in unserer Geschichte.“ Harald Welzer spricht von erforderlichen „mentalen Infrastrukturen“ und vom „Weiterbauen am zivilisatorischen Projekt“, auf dass eines Tages nicht mehr „die, die Müll produzieren“ ein „höheres gesellschaftliches Ansehen [genießen] als die, die ihn wegräumen“.
Und weil dieses Weiterbauen so schwierig, ja schier nicht machbar erscheint, hat sich der Innovationsforscher Dr. Felix Hoch mit einem kompakten Band nur diesem Thema gewidmet: „Schwellen der Transformation – Erkennen und Überwinden innerer Widerstände in Transformationsprozessen“. Thomas Metzinger, der an der Uni Mainz Philosophie und Kognitionswissenschaften lehrte, hat sich mit seinem kürzlich erschienenen Buch „Bewusstseinskultur – Spiritualität, intellektuelle Redlichkeit und die planetare Krise“ dem neuen Denkansatz ebenfalls gestellt. Verdienstvollerweise hat er das nicht auf einem akademisch hochfliegenden Niveau getan, sondern gut lesbar, klar und knapp auf 183 Seiten.
Inhaltlich leicht macht er es einem allerdings nicht. Schon in den ersten Zeilen nimmt er den Stier bei den Hörnern: „Wir müssen uns ehrlich machen … Die globale Krise ist selbstverschuldet, historisch beispiellos – und es sieht nicht gut aus … Wie bewahrt man seine Selbstachtung in einer historischen Epoche, in der die Menschheit als ganze ihre Würde verliert? … Wir brauchen etwas, das im tatsächlichen Leben einzelner Menschen und Länder auch dann trägt, wenn die Menschheit als ganze scheitert.“
Beschönigung der Lage ist Metzingers Sache nicht. Im Gegenteil sagt er voraus, „dass es in der Geschichte der Menschheit auch einen entscheidenden Kipppunkt geben wird“, einen Panikpunkt, nach dem „die Einsicht in die Unumkehrbarkeit der Katastrophe auch das Internet erreichen und sich viral verbreiten“ wird. Doch dabei belässt es Metzinger nicht, vielmehr sieht er ebenso nüchtern die Möglichkeit, dem Unvermeidlichen auf sinnvolle Art und Weise die Stirn zu bieten.
Dass das nicht einfach ist bzw. sein wird, versteht sich von selbst. Immerhin hat sich weltweit eine Gruppe von Menschen gebildet, Metzinger nennt sie die „Freunde der Menschheit“, die vor Ort alles dafür tun, „neue Technologien und nachhaltige Lebensweisen zu entwickeln, denn sie möchten Teil der Lösung gewesen sein“. Sie alle ruft Metzinger auf, an einer Bewusstseinskultur zu arbeiten, deren erster Schritt vielleicht der schwerste ist, „die Fähigkeit, nicht zu handeln … die sanfte, aber sehr präzise Optimierung von Impulskontrolle sowie eine schrittweise Bewusstwerdung der automatischen Identifikationsmechanismen auf der Ebene unseres Denkens“. Eine würdevolle Lebensform, so Metzinger, entstehe aus „einer bestimmten inneren Haltung angesichts einer existenziellen Gefährdung: Ich nehme die Herausforderung an“. Nicht nur Individuen, auch Gruppen und ganze Gesellschaften könnten so angemessen reagieren: „Wie kann es gelingen, angesichts der planetaren Krise in Bewusstheit und Anmut zu scheitern? Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als genau das zu lernen.“
Die zu entwickelnde Bewusstseinskultur wäre eine „Form des Erkenntnishandelns, die nach würdevollen Lebensformen sucht … Als antiautoritäre, dezentralisierte und partizipatorische Strategie wird Bewusstseinskultur im Wesentlichen auf Gemeinschaft, Kooperation und Transparenz setzen und sich so ganz automatisch jeder kapitalistischen Verwertungslogik verweigern. So gesehen handelt es sich … um den Aufbau eines soziophänomenologischen Raums – und damit einer neuen Art von gemeinsam geteilter geistiger Infrastruktur“.
Um sich nicht ideologisch zu verfestigen, besteht die hauptsächliche Herausforderung in der Entwicklung eines „Entdeckungskontexts“, der nicht vorgibt, „genau zu wissen, was sein sollte und was nicht … eine neue Form von ethischer Sensibilität und Echtheit … in Abwesenheit von moralischer Gewissheit … das Umarmen von Unsicherheit“. Daniel Christian Wahl hat dies als „Resilienz“ beschrieben. Sie hätte zwei Merkmale: einerseits die Fähigkeit lebender Systeme, ihre relative Stabilität im Laufe der Zeit aufrechtzuerhalten, andererseits die Fähigkeit, „sich als Reaktion auf veränderte Bedingungen und Störungen zu verändern“; Letzteres nennt er „transformative Resilienz“. Es gehe darum, „weise zu handeln, um eine positive Entwicklung in einer unvorhersehbaren Welt zu ermöglichen“. Sich offen zu halten, sich in einer Kultur des Nichtwissens in eine unvorhersehbare Zukunft zu tasten, bezeichnet Thomas Metzinger als „intellektuell redliche Bewusstseinskultur“. Ziel wäre eine „säkulare Spiritualität“ als eine „Qualität inneren Handelns“.
Mit den meisten spirituellen Bewegungen der letzten Jahrzehnte in Europa und den USA geht Metzinger freilich hart ins Gericht. Sie hätten ihren fortschrittlichen Impuls lange verloren und seien häufig zu „erfahrungsbasierten Formen privat organisierter religiöser Wahnsysteme verkommen … folgen kapitalistischen Imperativen der Selbstoptimierung und zeichnen sich durch eine etwas infantile Form von Selbstgefälligkeit“ aus. Ähnliches gelte für die organisierten Religionen, sie seien „von der Grundstruktur her dogmatisch und damit intellektuell unredlich“. Seriöse Wissenschaft und säkulare Spiritualität hätten eine doppelte gemeinsame Basis: „Erstens der unbedingte Wille zur Wahrheit, denn es geht um Erkenntnis und nicht um Glauben. Und zweitens das Ideal der absoluten Ehrlichkeit sich selbst gegenüber.“
Erst die neue Bewusstseinskultur, eine „säkulare Spiritualität von existenzieller Tiefe ohne Selbsttäuschung“, ein neuer Realismus, würde es ermöglichen, aus dem jahrhundertelang gepflegten, „giergetriebenen Wachstumsmodell“ auszusteigen. Dies könnte „zumindest einer Minderheit von Menschen dabei helfen, ihre geistige Gesundheit zu schützen, während die Gattung als ganze scheitert“. Metzinger geht es in seinem Buch nicht darum, Wahrheiten zu verkünden, sondern darum, mit größtmöglicher Nüchternheit den gegenwärtigen Entwicklungen ins Auge zu schauen: „Bewusstseinskultur ist ein Erkenntnisprojekt, und in genau diesem Sinne ist unsere Zukunft auch weiterhin offen.“
Thomas Metzinger, Bewusstseinskultur. Spiritualität, intellektuelle Redlichkeit und die planetare Krise, 22 Euro, Berlin Verlag, ISBN 978-3-8270-1488-7
Rezension von Bobby Langer
“Bewusstseinskultur” zählt aus unserer Sicht zu den wesentlichen Büchern des Wandels, die wir zur Lektüre und Vertiefung empfehlen.


