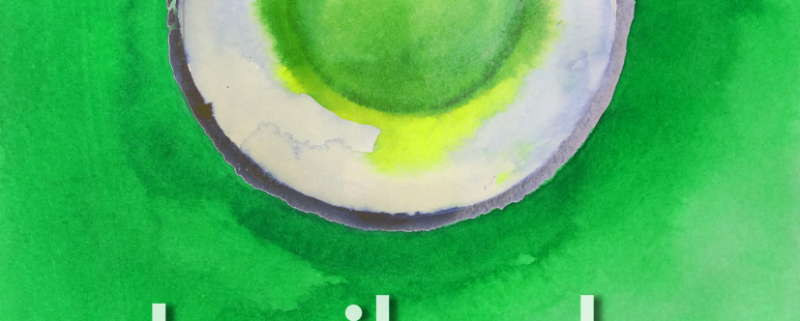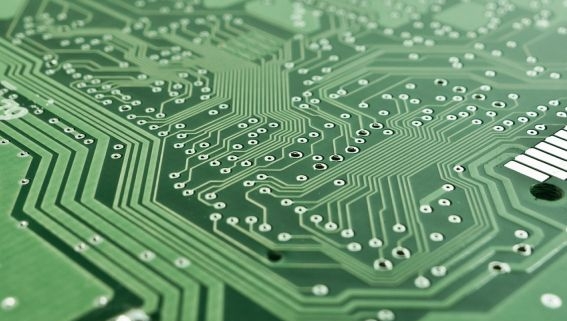Permakultur lässt sich aufs eigene Leben übertragen
“We are all elders in training …”
Mala Spotted Eagle
Mit „Krisen-Fest – wie wir aus Lebenslust die Welt retten. Eine Ode an unsere natürliche Resilienz“ schreibt Marit Marschall ein Handbuch für alle Menschen, die nicht „in Jammern und Leiden“ verharren wollen. „Wir Menschen haben Mist gebaut, und jetzt machen wir es besser“, konstatiert sie. Krisen-Fest ist ein poetisches, kluges Lehrbuch für all jene, die nach einer Methode suchen, wie sie in einer krisengeschüttelten Zeit persönlich als Mensch, aber auch – sofern sie das wollen – gärtnerisch, stabil werden und bleiben können.
Von Bobby Langer
Wie kann es sein, dass ein Ökosystem Jahrhunderte, ja Jahrtausende funktioniert, so lange der Mensch es in Ruhe lässt? Was sind die ineinandergreifenden Prinzipien eines solchen „Wunders“, haben sich die beiden Australier Bill Mollison und David Holmgren vor ein paar Jahrzehnten gefragt und haben sich auf die Suche nach Antworten gemacht. Heraus kam die „Permakultur“ mit Erkenntnissen, die sich in Windeseile über den Erdball verbreitet haben. Auch in Deutschland gibt es inzwischen Tausende von Anwendern der Permakultur-Prinzipien, die in Hausgärten ebenso gut funktionieren wie auf dem Bauernhof.
Längst hat sich Permakultur zu einer Agrar-Systemwissenschaft entwickelt, die die Grundlagen des biologischen Anbaus sowohl vervollständigt als auch erweitert. Und Permakultur lässt sich erlernen, in Deutschland in privaten Akademien, in Österreich sogar an der Universität für Bodenkultur Wien. Nach einer mehrjährigen Ausbildung erhält man den Abschluss als Permakultur-Designer/in.
Auch Marit Marschall hat auf der Suche nach der Quelle unserer natürlichen Resilienz diesen Weg gewählt. In ihrer Abschlussarbeit hat sie dargelegt, dass sich die „geistigen Werkzeuge“ der Permakultur auch auf die menschliche Lebensplanung anwenden lassen, als Design für die innere Landschaft. „Wir können uns ausprobieren als innerer Gärtner und Designer unseres Lebens“, sagt Marit Marschall. Dazu hat sie den „Baumplan“ entwickelt und seine Verwendung in ihrem Buch leicht verständlich, übersichtlich und kleinschrittig nachvollziehbar beschrieben. Die anmutigen und überraschenden Farbbilder der englischen Naturkünstlerin Amber Woodhouse verleihen dem Buch schon beim ersten Durchblättern einen gewissen Zauber.
„Krisen-Fest“ – die Schreibweise verweist auf eine Doppelbedeutung: Einerseits unterstützt die Autorin psychologisch wie permakulturell sachkundig dabei, krisenfest zu werden; dies aber nicht in einem statischen Sinn, sondern flexibel und widerstandfähig wie die Natur, in der jede Krise das Potential zu Entwicklung und Wachstum birgt.
Schritt für Schritt führt dieses Kompendium der Achtsamkeit aus der Permakultur-Perspektive die LeserInnen voran: vom sinnvollen Aufbau der eigenen Resilienzwurzeln über den Stamm des persönlichen Lebensbaums – die Analyse – bis hin zur zuverlässigen Ernte der Früchte: des eigenen Lebensertrags. Dabei gelingt Marit Marschall die Gratwanderung zwischen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und spirituellen Einsichten. Krisen-Fest ist kein Aufruf „Zurück auf die Bäume“, sondern vielmehr die Vision eines indigenen europäischen Lebens, bei dem Mitwelt und Mensch harmonisch klug miteinander verschmelzen. „Du lebst mehr im Einklang mit deinen Bedürfnissen und denen aller Lebewesen. Nicht mehr als Ausbeuter und ignoranter ‚Mensch‘, sondern als integrierter Bewohner des Planeten. So wie du es dir immer gewünscht hast.“
Im Kapitel „Die Wurzeln der Bedürfnisse“ zitiert die Autorin en berühmten Erfinder und Architekten R. Buckminster Fuller:
„Ich glaube, wir befinden uns in einer Art Abschlussprüfung, ob der Mensch mit dieser Fähigkeit zur Informationsbeschaffung und Kommunikation jetzt wirklich qualifiziert ist, die Verantwortung zu übernehmen, die uns übertragen werden soll. Und es geht hier nicht um eine Prüfung der Regierungsformen, es geht nicht um Politik, es geht nicht um Wirtschaftssysteme. Es hat etwas mit dem Individuum zu tun. Hat der Einzelne den Mut, sich wirklich auf die Wahrheit einzulassen?“
Krisen-Fest ist ein Mut-Buch in diesem Sinn, und ein Aufbruchsbuch für alle, die vielleicht noch einen letzten Impuls brauchen, um sich auf den Weg zu machen; ein Aufruf, die uns mögliche Souveränität anzunehmen und damit Verantwortung für unseren Lebensstil. Es ist aber auch eine detaillierte Aufmunterung voller gärtnerischer und permakultureller Details für alle, deren Weg sich manchmal beschwerlich anfühlt. „Handlungsfähig werden im individuellen wie im globalen Sinn“ – darum geht es hier. „Unsere innere Ausrichtung auf die konsequente Lebensqualität ist, was uns noch fehlt“, sagt Marit Marschall. „Mit diesem Buch kannst du dich darin schulen und ausbilden, deine Bedürfnisse als gesundes Ökosystem wieder zu spüren, deine Gedanken, dein Fühlen und Handeln an dem Maßstab der Prinzipien der Ökosystem zu prüfen und auszurichten. Du kannst damit deine ganze Qualität auf diesem schönen Planeten ohne Reue ausleben und verschenken.“
KRISEN-FEST – wie wir aus Lebenslust die Welt retten. Eine Ode an unsere natürliche Resilienz. Von Marit Marschall. Mit einem Interview mit Gerald Hüther.
310 S., 21,90 Euro, Europa Verlagsgruppe, ISBN 979-1-220-11656-5






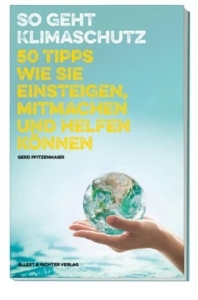 Wer sich auch nur ein bisschen mit der Klimakrise auseinandersetzt, kann angesichts der monumentalen Probleme leicht den Mut verlieren. Also schnell den Teppich anheben und das Problem drunterschieben? Mit Gerd Pfitzenmaiers Mut machendem Handbuch kann jeder ohne Umschweife zum Aktivisten werden. Man spürt, dass sich der Autor seit Jahrzehnten damit befasst, komplexe Mitweltthemen für ein breites Publikum verständlich aufzubereiten.
Wer sich auch nur ein bisschen mit der Klimakrise auseinandersetzt, kann angesichts der monumentalen Probleme leicht den Mut verlieren. Also schnell den Teppich anheben und das Problem drunterschieben? Mit Gerd Pfitzenmaiers Mut machendem Handbuch kann jeder ohne Umschweife zum Aktivisten werden. Man spürt, dass sich der Autor seit Jahrzehnten damit befasst, komplexe Mitweltthemen für ein breites Publikum verständlich aufzubereiten.