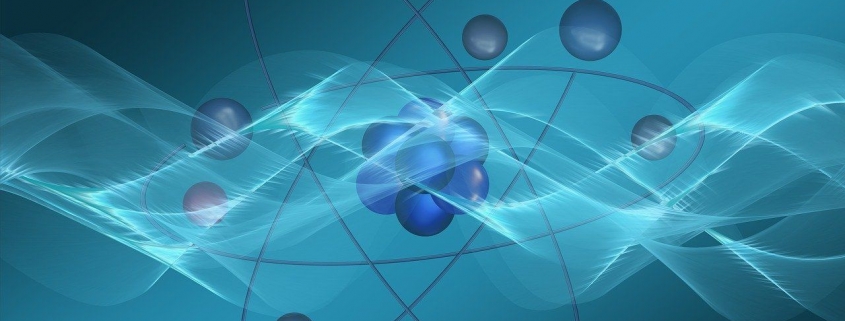Rezension von Lic. Theol. Peter Schönhöffer M.A. (Ingelheim)
Ein waschechter Narzisst, der erfolgsverwöhnt und doch leidenschaftlich-umtriebig aus der Perspektive eines kritischen Hedonismus schreibt… so gar nichts für mich an und für sich. Und doch sei die Lektüre, die sich wie in einem Sog lesen lässt, tatsächlich für Herz und Verstand, Eros und Logos empfohlen. Hier meldet sich eine fein ausbalancierte Stimme, hinter der im wahrsten Sinne des Wortes ein mit vielen postmodernen Wassern gewaschener Lebenscoach zu erspüren ist – und der – wenn man sich am narzisstischen Stallgeruch nicht stört, eine Menge zu sagen hat, was viele tiefreichend angeht.
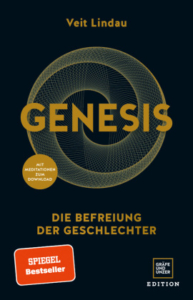 Wir stehen wohl gesellschaftsgeschichtlich gesehen tatsächlich an einem Punkt, den Heike Pourian von „sensing the change“ nüchtern so bezeichnet: „Lange konnten wir den Schmerz nicht erkennen, den wir mit unserer Zivilisation verursacht haben. Nun beginnen wir, das wahrnehmen zu können.“ Wenn dem so sein sollte, dann ist dieses Buch indes wie eine immerfort Nachdenkenswertes hervorsprudelnde Quelle auf dem Weg dorthin. Es schaut sich den Zusammenhang von Depression und fehlender Sakralität an, geht (ganz der Hedonist!) auf eine „postreligiöse Spiritualität“ zu, entwickelt einige in der Tat beeindruckende Facetten davon, lädt das „Schwert der Klarheit ein“, bleibt nicht bei Halbheiten stehen und ruft voller Glauben an deren Veränderungsfähigkeit alle aktiven Männer und Frauen als ekstatische Wesen, die sie sind, in einer geradezu mitreißenden Weise dazu auf, nicht länger weit unter ihren Potenzialitäten zu verbleiben; selbst wenn das 10.000 Jahre aus uns lastende Patriarchat noch tief in uns sitzt und seine Nachwirkungen uns nicht einfachhin freigeben werden.
Wir stehen wohl gesellschaftsgeschichtlich gesehen tatsächlich an einem Punkt, den Heike Pourian von „sensing the change“ nüchtern so bezeichnet: „Lange konnten wir den Schmerz nicht erkennen, den wir mit unserer Zivilisation verursacht haben. Nun beginnen wir, das wahrnehmen zu können.“ Wenn dem so sein sollte, dann ist dieses Buch indes wie eine immerfort Nachdenkenswertes hervorsprudelnde Quelle auf dem Weg dorthin. Es schaut sich den Zusammenhang von Depression und fehlender Sakralität an, geht (ganz der Hedonist!) auf eine „postreligiöse Spiritualität“ zu, entwickelt einige in der Tat beeindruckende Facetten davon, lädt das „Schwert der Klarheit ein“, bleibt nicht bei Halbheiten stehen und ruft voller Glauben an deren Veränderungsfähigkeit alle aktiven Männer und Frauen als ekstatische Wesen, die sie sind, in einer geradezu mitreißenden Weise dazu auf, nicht länger weit unter ihren Potenzialitäten zu verbleiben; selbst wenn das 10.000 Jahre aus uns lastende Patriarchat noch tief in uns sitzt und seine Nachwirkungen uns nicht einfachhin freigeben werden.
Auf diesem Weg lockt er sogar achtungsvoll den Wert alter Traditionen in neuem Gewand hervor und nimmt sich neben einer zuweilen tiefreichenden Kritik an zu kurz greifendem Feminismus und Konflikten aus dem Weg gehender psychospiritueller Szene auch die Zeit, auf eine sensible Weise, taugliche männliche Vorbilder zu zeichnen, die „nicht im Vorgarten der neuen Heiligtümer sitzen bleiben“ werden. So enthält das in kürzester Zeit bereits in dritter Auflage erscheinende Werk eine wertvolle Fülle an sehr lebenspraktisch evoziertem „Zukunftswissen“, immer wieder herausfordernd-zupackende rhetorisch angeschärfte Passagen, eine kristallklare Sprache und einen spannungsvollen Erkenntnisweg. Selbst ohne in einem tieferen Sinn wissenschaftlich fundiert daherzukommen, kann man ganz offensichtlich eine Menge aufregenden Erkenntnisgewinn gebären und Stoff zur weiteren Auseinandersetzung bieten, der an vielen Stellen geradezu weisheitliche Qualitäten erreicht und Leser, Leserin und LGBTQI+-community stets nicht so einfach davonkommen lässt.