In diesem zweiten Teil der Reihe geht es um den sogenannten Earth Overshoot Day, den Tag im Jahr, an dem wir dem Ökosystem mehr entnommen haben, als dieses natürlicherweise regenerieren kann.
→ Teil 2 von Daniel Christian Wahl
→ Teil 1
→ Teil 3
In diesem zweiten Teil der Reihe geht es um den sogenannten Earth Overshoot Day, den Tag im Jahr, an dem wir dem Ökosystem mehr entnommen haben, als dieses natürlicherweise regenerieren kann.
→ Teil 1
→ Teil 3
Krankheiten vermeiden? Besser Gesundheit kreieren. Umweltschäden reparieren? Besser ökologische Systeme schaffen, die sich selbst am Leben halten und regulieren können. Gesellschaftliche Brüche kitten? Besser aktiv Gemeinschaften organisieren, die die psychosoziale Gesundheit und das Wohlergehen einer möglichst großen Anzahl von Menschen dauerhaft gewährleisten. Unser politischer Diskurs ist zu sehr darauf fixiert, allgegenwärtige Verschlimmerungen aufzuhalten, abzumildern und im besten Fall rückgängig zu machen. So bleiben wir auf das Negative und dessen „Bekämpfung“ fixiert. Ins Positive gewendet, sollten ökologische und soziale Systeme mit einem hohen Grad an Resilienz geschaffen werden — weniger abhängig von andauernder menschlicher Korrektur, selbstreparierend, nachhaltig. Wie das funktionieren könnte, zeigt der Autor in seiner dreiteiligen Serie auf.
→ Teil 2
→ Teil 3
„Wie können wir es schaffen, mit zehn bis zwölf Milliarden Menschen gut auf dieser Erde zu leben? Wie erreichen wir für alle ein Leben in angemessenem Wohlstand, in Frieden und Freiheit und in einem global intakten und vielfältigen Ökosystem?“ Jascha Rohr
Von Bobby Langer
Könnte man den geläufigen Ausdruck „das Buch der Stunde“ auf eine ganze Epoche übertragen, dann träfe er auf dieses Buch zu. Es erhitzt sich nicht an – immer diskutablen – Inhalten, sondern beschäftigt sich klug, systematisch und auf viel Erfahrung zurückgreifend mit den uns bleibenden Möglichkeiten, das Ruder herumzureißen.
Der Autor Jascha Rohr beschreibt sein Buch folgendermaßen: „Wir haben einen kokreative Werkstatt in Form eines Buches vor uns, die aus einer Reihe von Werkräumen besteht, den Kapiteln dieses Buches. Unser Ziel ist der Entwurf für die große Kokreation.“
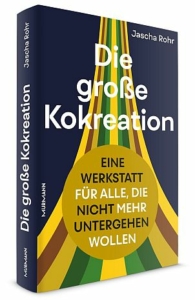 Kein Was ohne Wie
Kein Was ohne WieFür viele Laien, aber auch Experten in Sachen Nachhaltigkeit, Erderwärmung oder Artensterben sieht es eher hoffnungslos aus. Gleich dem vom Auge der Schlange gebannten Kaninchen stehen sie dem lebensverschlingenden Verhalten der industriellen Zivilisation ratlos gegenüber. Jascha Rohr hat – wenigstens für sich – diesen Bann gebrochen. Statt sich dystopischen Gedanken zu überlassen, überlegt er, wie eine nachhaltige Umgestaltung der Welt funktionieren könnte. Denn, so findet er, ohne über das Wie nachgedacht zu haben, brauchen wir uns über das Was erst gar keine Gedanken zu machen. „Die große Kokreation“ ist für ihn ein „Entwurf darüber, wie wir unsere globalen Probleme besser miteinander lösen können“. Die Zukünftigen lässt er rufen: „Stellt euch den Herausforderungen und Schwierigkeiten, entwickelt positive Wirkung. Baut auf das, was euch Kraft gibt und im besten Sinne wirkmächtig macht – auf eure Lebendigkeit, Kreativität, Freude und Liebe, eure Lust, Begeisterung, Intelligenz und Empathie.“
Rohrs Buch ist eine „Werkstatt für alle, die nicht mehr untergehen wollen“ – so der Untertitel. Das kann nicht anders als komplex und auf hohem theoretischen Niveau angegangen werden. Und doch gelingt es dem Autor, sich dem großen Thema klar, übersichtlich und auch sehr persönlich und menschlich zu nähern. Mit anderen Worten: Man muss nicht Sozialwissenschaften studiert haben, um es lesen zu können. Dazu trägt bei, dass Jascha Rohr sowohl induktiv wie deduktiv arbeitet; d. h. manchmal begibt er sich von einem praktischen Beispiel ausgehend auf die Metaebene, manchmal startet er gedanklich auf der Metaebene und belegt seine Gedanken durch ein Beispiel. Selbst die Grafiken sind dank ihrer Skizzenhaftigkeit besser nachvollziehbar und einprägsamer, als dies „perfekte“, theoriebezogene Grafiken normalerweise sind. Und noch eines macht sein Buch lesenswert: Es ist getragen von dem unbedingten Willen, Positives in die Welt zu bringen – ohne die Augen vor den drängenden Problemen zu verschließen.
Entscheidend für Jascha Rohr: Es geht nicht um fertige inhaltliche Lösungen, sondern um die „Beschreibung des Wie …, also eines Prozesses. Dieser Prozess hat im Grunde längst schon begonnen … Es ist ein Prozess, in dem wir miteinander lernen, unsere Probleme ganz anders zu lösen, als wir es bisher versuchen … Das Ziel ist nichts Geringeres als die Neuerfindung unserer planetaren Zivilisation.“ Ein hoher Anspruch.
Die zentrale Methode für dieses „Global Resonance Project“ nennt er „Resonanzarbeit“. Und das ähnelt keiner bekannten Methode, ganz im Gegenteil: „Resonanzarbeit folgt keiner festen Strategie, sondern ist mäandernd, verknüpfend, assoziativ. Sie stellt vielfältige Verbindungen und Beziehungen her, um Kreativität, Ideen und Innovationen anzuregen. Im Idealfall entsteht daraus am Ende ein kokreativer Entwurf.“ Der Prozess ist „entwurfsorientiert. Er ist ein Angebot zum Selbstdenken, zum Entwickeln und Mitgestalten … [Das Buch] bietet die Möglichkeit der Auseinandersetzung in einem Feld – in diesem Fall ist das die planetare Zivilisation –, damit dann aus dem eigenen Impuls heraus und mit den eigenen Potenzialen und Möglichkeiten transformatorische Projekte entwickelt und in die Umsetzung gebracht werden können, sodass am Ende eine reale Veränderung in der Welt entsteht“.
Jascha Rohr geht es um zwei Fragen:
„Wie kann es sein, dass wir als Spezies unsere eigenen Lebensgrundlagen zerstören?“
Und: „Was kann Kokreation dazu beitragen, dass sich diese Dynamik zum Positiven wendet?“
Der Leser kann, wenn er möchte, mitverfolgen und dabei erlernen, wie sich Methoden in kokreativen Prozessen kontextspezifisch aus dem Prozess entwickeln und ist eingeladen, „in der eigenen Praxis mit diesen Ansätzen zu experimentieren“. Personen, die an eigenen Prozessen und Projekten arbeiten, empfiehlt Jascha Rohr, das Buch mit dem eigenen Projektteam zu lesen.
Klar: „Benutzen wir … die Werkzeuge der alten Zivilisation, kann nur eine neue Version der alten Zivilisation dabei herauskommen.“ Um diesem Fehler nicht zu erliegen, kommt die Kokreation ins Spiel, ein Wort, das der „Kooperation“ oder „Kollaboration“ ähnelt, sich aber deutlich davon unterscheidet. So bezieht sich das „Ko“ in Kokreation nicht nur auf Mitmenschen, sondern auf die gesamte Mitwelt, also auf alle Mitgeschöpfe, auch: Mitdinge. Es geht darum, Mittel und Wege zu finden, „mit der gesamten Welt gemeinsam zu gestalten, statt die gesamte Welt als Menschen zu gestalten“. Das klingt in der Tat nicht mehr nach einem „Werkzeug der alten Zivilisation“. Der Wortteil „kreation“ in Kokreation bezieht sich auf Kreativität als Grundlage von Emergenz in Kunst und Kultur, wozu unbedingt auch Architektur, Philosophie, Ingenieurskunst und Wissenschaft gehören. Anders als in der alten Zivilisation lässt sich in einem kokreativen Entwurfsprozess „meist gar kein klares Ergebnis definieren, sondern eher einen Ergebnistyp“. Auf der Suche nach neuen Lösungsansätzen werden „die Themen, Akteure und Kontexte aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und zueinander in Beziehung gesetzt“.
Der Vater aller Probleme ist der Subjekt-Objekt-Dualismus, den Jascha Rohr als „ontologisches Grundproblem der ökologischen Krise“ identifiziert. Um sich von ihm zu lösen, sind die entscheidenden begrifflichen Werkzeuge:
Das Feld: „die räumliche Konstellation von miteinander interagierenden Partizipateuren und ihre Wirkungen aufeinander“ (auch: „die Wirkungen und Kräfte, die sich zwischen den Elementen aufspannen“). Anders als „Systeme“ sind Felder nicht durchschaubar und nicht steuerbar.
Der Prozess: „die sich zeitlich entfaltende Dynamik eines Feldes“, bestehend „aus allen diesen Prozess prägenden Partizipateuren, deren Wirkungen und Interaktionen sowie der fortschreitenden generativen Entwicklung, die daraus resultiert“. Besonders wichtig und auch schon in kleinem Rahmen anwendbar und aufs Größere übertragbar: „Prozesse sind fraktal und verschachtelt.“ Zur Erklärung des damit Gemeinten: „Unser Leben ist ein Prozess, aber unsere Ausbildung, Beziehungsphasen und die Phasen, in denen wir einer bestimmten Profession nachgehen, sind ebenfalls Prozesse.“
Indem Rohr die Begriffe „Subjekt“ und „Objekt“ abschafft und durch „Partizipateur“ ersetzt, schafft er die gedankliche Voraussetzung für einen tatsächlich ontologischen Paradigmenwechsel: „Alle Dinge der Welt sind Dinge der Welt, weil sie an der Welt teilhaben.“ Folgerichtig können auch „eine Geschichte, eine Kaffeetasse, eine Blume und die Gravitation“ Partizipateure sein: „Alles in der Welt ist Partizipateur, wenn es wirkt und teilhat. Was nicht wirkt und an nichts teilhat, existiert nicht.“
Zusammenfassend: „Ein Feld ist ein Prozess zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ein Prozess ist ein Feld in seiner dynamischen Entfaltung.“ Die große Aufgabe, die Zukunft zu gestalten, kann folglich kein „funktionales Gestalten“ sein – das wäre das Übliche –, sondern „ein generatives, wechselseitiges, fluides Interagieren mit den Prozessen, die uns gestalten, während wir gestalten“. Erst wenn wir „die Dinge in ihrer jeweiligen intrinsischen Eigenart als Gegenüber anerkennen“, wird tatsächlich ein Ausweg aus dem Subjekt-Objekt-Dualismus vorstellbar hin zu einer ökologischen, kokreativen Demokratie.
Die dazu fähige und dafür notwendige Kulturtechnik ist die Kokreation. „Sie ist das Wie: Wie gestalten wir gemeinsam. Das Was ergibt sich dann daraus … das wird synchron passieren: Wir werden diese erst in den Anfängen sichtbare Kulturtechnik entdecken, entwickeln, erfinden, erlernen und trainieren müssen, während wir beginnen, sie anzuwenden und erste Ergebnisse zu produzieren.“
Und das ist dabei die Herausforderung: „Da rollt die phantastischste Wahnsinnswelle auf uns zu, die wir je haben reiten können. Der Einsatz ist hoch, die Welle gefährlich, möglicherweise tödlich, aber der Ritt, den wir nehmen könnten, kann der beste unseres Lebens werden.“ Sich dem zu stellen, ist eine gewaltige und riskante Aufgabe mit ungewissem Ausgang. Das schätzt auch Jascha Rohr so ein und gesteht: „Dieses Buch ist ein Wagnis und der Versuch, eine visionäre Geschichte zu erzählen.“ Ihm zuzuhören, ist fesselnd und lädt ein, dabei zu sein beim „planetaren Fest der Gestaltung“.
Jascha Rohr, Die große Kokreation. Eine Werkstatt für alle, die nicht mehr untergehen wollen. 400 S., 39 Euro, Murmann Verlag, ISBN 978-3-86774-756-1
[Dieser Artikel ist unter einer Creative Commons-Lizenz (Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine inhaltlichen Bearbeitungen 3.0 Deutschland) lizenziert. Unter Einhaltung der Lizenzbedingungen darf er verbreiten und vervielfältigen werden.]
Kein Geringerer als Fritjof Capra meinte zu dem im Folgenden besprochenen Buch „Regenerative Kulturen gestalten“: „Dieses Buch ist ein wertvoller Beitrag zu der Diskussion über die Weltanschauung, die wir brauchen, um unsere gesamte Kultur so zu gestalten, dass sie sich regeneriert und nicht zerstört.“
Rezension von Bobby Langer
Womit Fritjof Capra die Aufgabenstellung, um die es geht, auf den Punkt gebracht hat: „unsere gesamte Kultur so zu gestalten, dass sie sich regeneriert und nicht zerstört.“ Die Betonung liegt auf „gesamte Kultur“. Kein Mensch, auch keine Organisation könnte diese Mammut-Aufgabe schaffen. Und doch muss sie sein, wenn wir nicht im größten anzunehmenden Unglück landen wollen, das dereinst die Menschheit ereilen wird.
Richtige Fragen statt richtiger Antworten
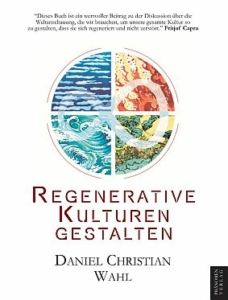 Daniel Christian Wahl (DCW) hat diese ungeheure Aufgabe mit seinem Buch in den Blick genommen. Nicht weil er wüsste, wie es geht, sondern weil er zumindest ganz gut weiß, wie es nicht geht: mit business as usual. So besteht seine Leistung letztlich aus einer gedanklichen Doppelarbeit: einerseits die ausgetretenen Pfade der Irrtümer und zuverlässigen Zerstörungen zu analysieren und andererseits Mittel und Methoden zu beschreiben, mit denen sich erstere vermeiden lassen. Die wichtigste Methode dabei lässt sich mit Rilkes berühmtem Satz zusammenfassen: „Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein.“ Es geht also nicht darum, die richtigen Antworten zu geben, sondern die richtigen Fragen zu stellen. Erst wenn es uns gelingt, die Richtung zu ändern, mit der wir uns in die Zukunft bewegen, können sich brauchbare Erfolge einstellen. Was geschieht, wenn wir das nicht tun, beschreibt ein chinesisches Sprichwort: „Wenn wir unsere Richtung nicht ändern, werden wir wahrscheinlich genau dort landen, wo wir gerade hingehen.“
Daniel Christian Wahl (DCW) hat diese ungeheure Aufgabe mit seinem Buch in den Blick genommen. Nicht weil er wüsste, wie es geht, sondern weil er zumindest ganz gut weiß, wie es nicht geht: mit business as usual. So besteht seine Leistung letztlich aus einer gedanklichen Doppelarbeit: einerseits die ausgetretenen Pfade der Irrtümer und zuverlässigen Zerstörungen zu analysieren und andererseits Mittel und Methoden zu beschreiben, mit denen sich erstere vermeiden lassen. Die wichtigste Methode dabei lässt sich mit Rilkes berühmtem Satz zusammenfassen: „Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein.“ Es geht also nicht darum, die richtigen Antworten zu geben, sondern die richtigen Fragen zu stellen. Erst wenn es uns gelingt, die Richtung zu ändern, mit der wir uns in die Zukunft bewegen, können sich brauchbare Erfolge einstellen. Was geschieht, wenn wir das nicht tun, beschreibt ein chinesisches Sprichwort: „Wenn wir unsere Richtung nicht ändern, werden wir wahrscheinlich genau dort landen, wo wir gerade hingehen.“
Aber lohnt es sich denn überhaupt, die Richtung zu ändern, um die kulturellen Errungenschaften der Menschheit zu erhalten? Immer wieder taucht diese Frage auf, die wohl die gesamte Transformationsbewegung weltweit umtreibt. DCW hat darauf eine klare Antwort:
„Wir wissen weder, dass eine andere Spezies Gedichte schreibt oder Musik komponiert, um das verbindende Gefühl, das wir Liebe nennen, widerzuspiegeln, noch wissen wir, wie sich das Vergehen der Jahreszeiten für einen Mammutbaum anfühlt oder wie ein Kaiserpinguin subjektiv die ersten Sonnenstrahlen nach dem antarktischen Winter erlebt. Aber gibt es nicht etwas Schützenswertes an einer Spezies, die sich solche Fragen stellen kann?“
Vier Einsichten für eine lebenswerte Zukunft
Wie ein roter Faden zieht sich eine Kern-Einsicht des Autors durch alle Kapitel: dass wir nämlich nicht wissen können, was auf uns zukommt. Nur wenn wir kokreativ mit dieser Unsicherheit umzugehen bereit sind und unser Verhalten immer wieder neu justieren, haben wir eine echte Chance. Eine zweite Einsicht gesellt sich zur ersten. Sie ist der Natur abgeschaut: Zu schaffen sei ein lebendiger, ein regenerativer Prozess, der bis ins Detail das Leben fördert. Denn Natur ist Leben, das Leben fördert. Und auch mit einem dritten Prinzip ist die Natur als Vorbild zu nehmen: dass sie nämlich – so groß sie ist und so universell ihre Gesetze sind – nicht in Monopolen funktioniert, sondern in kleinen, lokalen und regionalen Netzwerken, Netze in Netzen in Netzen. Was wir brauchen, schreibt DCW, ist ein „Feingefühl für den Maßstab, die Einzigartigkeit des Ortes und die lokale Kultur“. Und: „Wir müssen das traditionelle ortsbezogene Wissen und die Kultur wertschätzen, ohne in die Fallen eines wiederauflebenden radikalen Regionalismus und engstirnigen Pfarrei-Denkens zu tappen … Systemische Gesundheit als emergente Eigenschaft regenerativer Kulturen entsteht, wenn lokal und regional angepasste Gemeinschaften lernen, innerhalb der durch die ökologischen, sozialen und kulturellen Bedingungen ihrer lokalen Bioregion gesetzten ‚förderlichen Einschränkungen‘ und Möglichkeiten in einem global kooperativen Kontext zu gedeihen.“
Ein viertes Prinzip lässt sich von diesen drei nicht trennen: das Vorsorgeprinzip, das damit beginnt, für die jederzeit möglichen Änderungen der Umstände vorgesorgt zu haben. Unter Vorsorge versteht DCW aber auch unsere Haltung, mit der wir gestaltend mit der Welt umgehen. „Wir brauchen dringend einen hippokratischen Eid für Design, Technologie und Planung: Do no harm! Um diesen ethischen Imperativ in die Tat umzusetzen, brauchen wir eine salutogene (gesundheitsfördernde) Absicht hinter allem Design, aller Technologie und Planung: Wir müssen Design machen für Menschen, Ökosysteme und die Gesundheit des Planeten.“ Ein solches Design „erkennt die untrennbare Verbindung zwischen menschlicher, ökosystemischer und planetarischer Gesundheit an“. Um da hinzukommen, sei das Meta-Design, das „Narrativ der Trennung“, zu ändern hin zu einem „Narrativ des Interbeing“; Design sei der Ort, an dem sich Theorie und Praxis treffen.
Mit Bescheidenheit und Zukunftsbewusstsein handeln
Auf Basis dieser Überlegungen und Analysen entsteht im Laufe der rund 380 Seiten dann doch eine Art Werkzeugkasten für den Umbau der westlichen Industriekultur. Dazu hat DCW alle gedanklichen und praktischen Ansätze der letzten Jahrzehnte ausgewertet und in seine Überlegungen miteinbezogen. Es geschieht ja schon so viel weltweit auf allen Kontinenten. Nun gilt es, alle diese Bemühungen in einen gemeinsamen Prozess einmünden zu lassen, um „the great turning“, wie Joana Macy das nannte, ins Werk zu setzen.
Konsequenterweise hat DCW zu jedem Kapitel ein Fragenset erarbeitet, das dabei unterstützen soll, den statischen Ist-Zustand des jeweiligen Themas aufzugeben und in einen zukunftsfähigen Prozess zu überführen: die chemisch-pharmazeutische Industrie, die Architektur, die Stadt- und Regionalplanung, die industrielle Ökologie, die Gemeinschaftsplanung, die Landwirtschaft, das Unternehmens- und Produktdesign. Denn „systemisches Denken und systemische Interventionen sind mögliche Gegenmittel für die unbeabsichtigten und gefährlichen Nebenwirkungen der jahrhundertelangen Konzentration auf reduktionistische und quantitative Analysen, die von dem Narrativ der Trennung geprägt sind“. So lautet eine Kernfrage, um die so unabdingbare „transformative Resilienz“ zu erreichen: „Wie können wir angesichts der Unvorhersehbarkeit und Unkontrollierbarkeit komplexer dynamischer Systeme mit Bescheidenheit und Zukunftsbewusstsein handeln und vorausschauende und transformative Innovationen anwenden?“
Tatsächlich hat es etwas Entlastendes zu wissen, dass wir keine endgültigen Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit geben müssen bzw. gar nicht geben sollen. „Indem wir die Fragen gemeinsam leben“, schreibt DCW, „anstatt uns mit endgültigen Antworten und dauerhaften Lösungen zu beschäftigen, können wir den vergeblichen Versuch aufgeben, unseren Weg in die Zukunft zu kennen.“ So hat sein Buch letztlich mehrere Wirkungen auf den Leser: Es ist entlastend, inspirierend, informativ, Hoffnung machend und praxisorientiert zugleich – ziemlich viel für ein Buch.
Daniel Christian Wahl, Regenerative Kulturen gestalten, 384 S., 29,95 Euro, Phänomen Verlag, ISBN 978-84-125877-7-7
„Die Klimakrise ist kein Wohlfühlproblem“, sagt Luisa Neubauer, „sondern eine Katastrophe.“ Das pfeifen inzwischen die Spatzen von den Dächern, etwa des Ahrtals, nicht jedoch im Regierungsviertel.
Inzwischen hat sich sogar Marcel Fratzscher in die Diskussion eingeschaltet. Der Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und Professor für Makroökonomie an der Berliner Humboldt-Universität formuliert ähnlich dringlich wie Luisa Neubauer: „Wir haben eine dramatische Situation für die Wirtschaft. Viele Unternehmen können mit den hohen Energiepreisen über fossile Energieträger nicht umgehen, sind von Insolvenz und Überschuldung bedroht. Wir riskieren, dass unser Wirtschaftsmodell wegbricht.“ Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kosten, so der Professor, würden in Zukunft deutlich weiter zunehmen, „wenn es uns jetzt nicht gelingt, die notwendige Transformation voranzubringen“. Der Einwand, 100 Milliarden Euro seien zu viel Geld für Klimaschutzmaßnahmen, sei falsch, genau das Gegenteil treffe zu. „Je länger wir warten, desto höher sind nicht nur die Kosten für die Menschen, sondern eben auch die wirtschaftlichen Kosten für Unternehmen.“ Fratzscher will deshalb die Initiative von Fridays for Future „ganz nachdrücklich unterstützen“.
Wer ein Haus plant, benötigt ein geologisches Gutachten. Warum? Die Antwort ist jedermann einsichtig. Wer will schon, dass sein Haus wegrutscht, einsinkt oder auf einer alten Giftmülldeponie errichtet wird?
Wer ein Haus baut, braucht also ein solides Fundament, auch unterhalb der Bodenplatte. Das gilt nicht nur für relativ kleine wirtschaftliche Vorhaben, sondern auch für große. Die Bodenplatte, wenn man so will, auf der die deutsche Wirtschaft ruht, ist ihre zuverlässige Energieversorgung. Aber unter der Bodenplatte bröckelt es nicht nur, sondern es verschieben sich ganze Gesteinsschichten – nicht erst, seit uns die Gasversorgung knapp wird, sondern seitdem man zuverlässig weiß, dass die fossilen Ressourcen garantiert wegbrechen werden, also seit Jahrzehnten.
Der gesunde Menschenverstand legt folglich seit Jahrzehnten nahe, sich verantwortungsvoll um eine weniger riskante Energieversorgung zu kümmern. Aber seit Jahrzehnten funktioniert der gesunde Menschenverstand nicht. Im Gegenteil: Die Bundesregierung pumpt nach wie vor 65 Milliarden Euro im Jahr in Erdöl und Erdgas, statt diese widersinnigen Investitionen in zukunftsfähige Quellen umzulenken. Da setzt das Aushängeschild der deutschen Finanzwirtschaft, die Deutsche Bank, noch den i-Punkt an Zukunftsvergessenheit und Ruchlosigkeit obendrauf: mit ihrer geplanten Finanzierung der EACOP-Pipeline, mit der 1445 Kilometer geheiztes Erdöl vom Westen Ugandas durch Tansania zum Indischen Ozean gebracht werden soll. Rund 7000 Menschen wurden dafür bereits zwangsumgesiedelt, weitere ca. 90.000 Menschen sollen noch ihre Heimat verlieren – ganz abgesehen davon, dass das Tilenga-Ölfeld zum Teil im Murchison-Falls-Nationalpark liegt, dem größten und ältesten ugandischen Nationalpark. Aber wen kümmert das schon, außer Luisa Neubauer? Bei einem 3,5-Milliarden-Dollar-Projekt lässt sich schließlich gut verdienen. Und was tut die Bundesregierung? Es geht sie nicht wirklich etwas an, auch nicht die Bundesumweltministerin.
Gewichtige Argumente pro 100 Mrd. Euro liefert auch Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Berlin. 100 Mrd. Euro in Klimaschutzmaßnahmen in Deutschland würden das Geld im Land lassen und den Menschen zugute kommen, statt „weiter auf den Import von Öl, Kohle und Gas zu setzen“. Allein in diesem Jahr würde Deutschland voraussichtlich weit über 100 Milliarden Euro für den Import dieser fossilen Energieträger ausgeben. Quaschning: „Zwischen 1990 und heute hat Deutschland mehr als 1500 Milliarden Euro nur für den Import von Öl, Kohle und Gas ausgegeben, das heißt also Geld, was aus Deutschland weg ist und was wir nicht investieren können.“
Mit Bezug auf die Green-New-Deal-Überlegungen der Europäischen Union findet Fratzscher die Fridays-Forderung eher moderat. In Brüssel gehe man von einem zusätzlichen Investitionsbedarf von 10.000 Milliarden bis 2050 aus. Für Deutschland seien das hochgerechnet 120 Mrd. pro Jahr bzw. drei Prozent des BIP. Hoffnungen weckt in Fratzscher „die tolle Forschungslandschaft. Wir waren weltweit die ersten, die in die Energiewende eingestiegen sind, aber wir haben irgendwann immer die Puste verloren“. Es ist also neues Luftholen angesagt. Um die Energiewende voranzubringen, braucht Deutschland aus Quaschnings Sicht „das größte Fort- und Weiterbildungsprogramm, das die Bundesrepublik Deutschland jemals gesehen hat. Und Sie können natürlich ohne Geld keine Weiterbildung machen, also auch hier brauchen wir natürlich massive Investitionen.“ Und Fratzscher warnt: „Wir können es uns in Deutschland nicht leisten, diese Transformation zu verschlafen, weil sonst andere Länder und andere Unternehmen – Wettbewerber von deutschen Unternehmen – da schneller sind.“
… findet Asra und stellt sich entschlossen gegen den Zeitgeist, der nur noch von der einen Katastrophe zum nächsten Unheil eilen mag.
In ihrem Blogeintrag erzählt sie von zwei jungen Leuten, die es geschafft haben, durch die Coronazeit hindurch und ohne Bankkredit eine echte Dorfbrauerei aufzubauen. Das macht Mut und inspiriert, sich vom Zeitgeist nicht niedermachen zu lassen.
Aus einer Kooperation von ökoligenta mit der britischen Plattform The Daily Alternative
21.10.2021
Grüne Parteien sind in Koalitionsregierungen in ganz Europa aktiv (siehe Schottland, Island und in Deutschland) und haben überall auf dem Kontinent Einfluss. Doch Koalitionen setzen diese Parteien unter Druck: Wird ihr Klimaradikalismus verwässert, wenn sie Kompromisse eingehen und sich die Macht teilen? Daher ist es gut zu sehen, dass die österreichischen Grünen, die Teil einer Koalitionsregierung sind, einen wichtigen politischen Sieg errungen haben.
Für 3 € pro Tag kann man ab 26. Oktober 2021 mit einem staatlich subventionierten KlimaTicket überall in den öffentlichen Verkehrsmitteln Österreichs fahren, so weit Sie können. Wie die Financial Times berichtet:
Das Ministerium von Leonore Gewessle, zuständig für Verkehr, Umwelt, Energie und Technologie, hatte einen schweren Stand, um Österreichs regionalisiertes Verkehrssystem und den Flickenteppich privater Betreiber in ein einheitliches System zu bringen. Erst in den letzten Wochen wurde endlich eine Einigung erzielt, um alle Regionen Österreichs mit ins Boot zu holen.
„Wenn dieser Sommer uns etwas gezeigt hat, dann, dass die Klimakrise bereits bei uns angekommen ist“, sagte Gewessler mit Blick auf die großflächigen Überschwemmungen in Mitteleuropa. Nach Schätzungen des Verkehrsministeriums wird das System den österreichischen Steuerzahler jährlich zusätzliche 150 Millionen Euro kosten.
Kostenlose öffentliche Verkehrsmittel sind in vielen Städten, Regionen und kleinen Staaten eine wichtige systemische Antwort auf die Förderung klimafreundlicher Verhaltensweisen. Wie der New Scientist berichtet, „bieten mehr als 100 Städte kostenlose Verkehrsmittel für ihre Einwohner an, darunter Dünkirchen in Frankreich, Tallinn in Estland und einige in den USA sowie das gesamte Land Luxemburg“.
Auch im Vereinigten Königreich gibt es kleine Ansätze davon. Die schottischen Grünen setzen sich im Holyrood-Parlament für kostenlose Busfahrten für Personen unter 22 Jahren ein.
[Übersetzung von https://www.thealternative.org.uk/dailyalternative/2021/10/3/greener-transport-austria-3euro-daily]
Übersetzung erfolgte durch Bobby Langer in Absprache mit Indra Adnan
———————–
(Foto von Simon Tartarotti auf Unsplash)
Wir brauchen die Transformation unserer Gesellschaft vom Ich zum Du zum Wir, denn in der Wir-Qualität verbinden sich die Potenziale des Einzelnen mit den Potenzialen von vielen zum Wohle des Ganzen. Weiterlesen
Die Entstehung des Geldes ist fast in Vergessenheit geraten; nur ein paar Artefakte haben die Jahrtausende überdauert. Die ursprüngliche Handhabung war, eine Währung als Tauschmittel (anstatt der tatsächlichen natürlichen Güter) anzuerkennen.
In diesen frühen, sehr gerecht angelegten Geldsystemen war eine Zinsentwicklung, wie wir sie heute kennen, nicht vorgesehen und sogar gar nicht möglich. Über die Jahrtausende hat sich das Geld zu einem, in den Ursprüngen nicht gewollten, Zins- und Zinseszinssystem gewandelt. Die Folgen sind hinreichend bekannt.
Abschied vom Größenwahn. Wie wir zu einem menschlichen Maß finden. Von Ute Scheub, Christian Küttner.
22 Euro, ISBN 978-3-96238-205-6, oekom Verlag
„Drei Molkereien reichen aus, um ganz Deutschland mit Milchprodukten zu versorgen.“ Mit dieser Aussage schockierte mich ein sehr freundlicher Vertreter einer großen Molkereikette in einem Gespräch im Rahmen der Recherchen für diese Rezension. Da stellte sich mir die Frage: Woher kommt der Gegensatz zwischen der persönlichen Einstellung und dem Handeln in Großstrukturen?
„Abschied vom Größenwahn. Wie wir zu einem menschlichen Maß finden.“ Schon der etwas sperrig wirkende Titel des fast 300 Seiten dicken, im September 2020 im oekom-Verlag erschienenen Buches wirft Fragen auf, ja mag provozieren.
Ziel des Buches ist es dabei nicht in erster Linie, konkrete Anleitungspunkte für nachhaltiges Handeln zu geben, sondern vielmehr einen reflektierten Überblick. Dabei finden in dem spannend zu lesenden Buch selbst Leute, die sich mit der Materie bereits auskennen – nicht zuletzt dank der aktuellen, exemplarischen positiven Beispiele – noch einiges Interessante, Neue, Überraschende.
Das einleitende Kapitel „Größenwahn oder menschliches Maß“ umfasst das erste Drittel des Buches. Sehr umfangreich wird dort versucht, die vielfältigen Krisen und Probleme unserer Zeit wie Epidemien, Klimakrise und Artensterben in einen Gesamtzusammenhang zu bringen.
Die Autoren, zwei Aktivisten zivilgesellschaftlicher Initiativen und IT-Berater für Organisationen wie den Bundestag, beklagen und beschreiben die größenwahnsinnige Art der gegenwärtigen Globalisierung und die Auswüchse des gegenwärtigen Modells. Dabei werden immer wieder Bezüge zur aktuellen, bedrückenden Corona-Pandemie hergestellt und diese als als Symptom einer Systemkrise beschrieben: Die Corona-Krise hat deutlich gemacht, wie verletzlich wir uns mit unserem Zivilisationsmodell gemacht haben, etwa in der Massentierhaltung sowohl mit ihrem Umgang mit den Tieren wie auch den dort Beschäftigten, als auch mit der leichten weltweiten Ausbreitung über die globalen Flug- und Handelsrouten.
Dem werden kleinteilige, selbstorganisierte und lokal angepasste Strukturen entgegengestellt:
Selbstbewusst schreiben die Autoren: „Wir alle sind aufgerufen, liebevolle Sterbebegleitung des alten Systems zu leisten, und dieses Buch will dazu seinen kleinen Beitrag leisten.“
Auf die Schilderung des Verlustes des menschlichen Maßes aufbauend widmen sich fünf Kapitel verschiedenen zentralen Bereichen: Ernährung, Lebensorten, Wirtschaft, Gesundheitssystem und Demokratie. Hier wird nach grundsätzlichen Betrachtungen eine Vielzahl von Initiativen vorgestellt. Das abschließende Kapitel „Abschied vom Größenwahn“ unternimmt den nicht einfachen Versuch eines Resümees.
Auf den ersten Blick fällt die gelungene Gestaltung des Buches in vielerlei Hinsicht auf: So wird jedes Kapitel des Hauptteiles umrahmt von einer einheitlichen Gestaltung. Treffende Zitate zu Beginn und Zukunftsvisionen zum Ende umrahmen die einzelnen Kapitel. Sie liefern eine grundlegende Analyse des jeweiligen Problemfeldes, etwa der „Ernährung“, abgesichert durch eine Vielzahl von Zitaten bekannter und renommierter Autoren. Der emanzipatorische Ansatz der Visionen ist teils inspirierend, schlägt dabei für meinen Geschmack jedoch zuweilen ins gegenteilige Extrem um.
Die meiner Ansicht nach teils zu holzschnittartig bemühten und ideologisch gefärbten Visionen, sowie einigen kleineren logischen Ungereimtheiten, wie etwa der Forderung nach Selbstverwaltung, -organisation und Freiheit einerseits und der nach Großstrukturen wie einem europäischen Stromnetz, Vorgaben und Regeln andererseits sind diese Schwächen jedoch vor dem Hintergrund der Qualitäten des Buches zu vernachlässigen.
Dieses Buch liefert viel Theorie; dabei werden ganz grundsätzliche Fragen etwa nach dem Genug, also Genügsamkeit nicht klar genug gestellt. Stattdessen wird das bestehende System mit ausführlich anekdotenhaft geschilderten Auswüchsen kritisiert. Dem werden eine Vielzahl schon jetzt bestehender Initiativen sowie Visionen für eine nachhaltigere Zukunft entgegengestellt.
Für den nötigen und kommenden großen Wandel mag das vielleicht nicht ausreichend sein, es ist aber nötig und hilfreich. Das macht das Buch zu einem guten Rundumschlag. Es macht Mut und Lust auf die Veränderung. Nicht zuletzt lädt es mit den vielen Zitaten und Kontakten zur weiteren und tiefergehenden Beschäftigung ein.
Übrigens: Die aktuelle Anzahl der Molkereien in Deutschland: unter 100. 1990 waren es noch fünfmal so viele). Wie und wohin wollen wir uns entwickeln?


