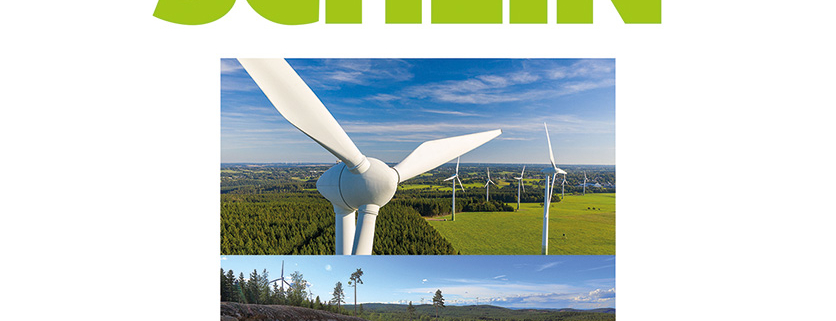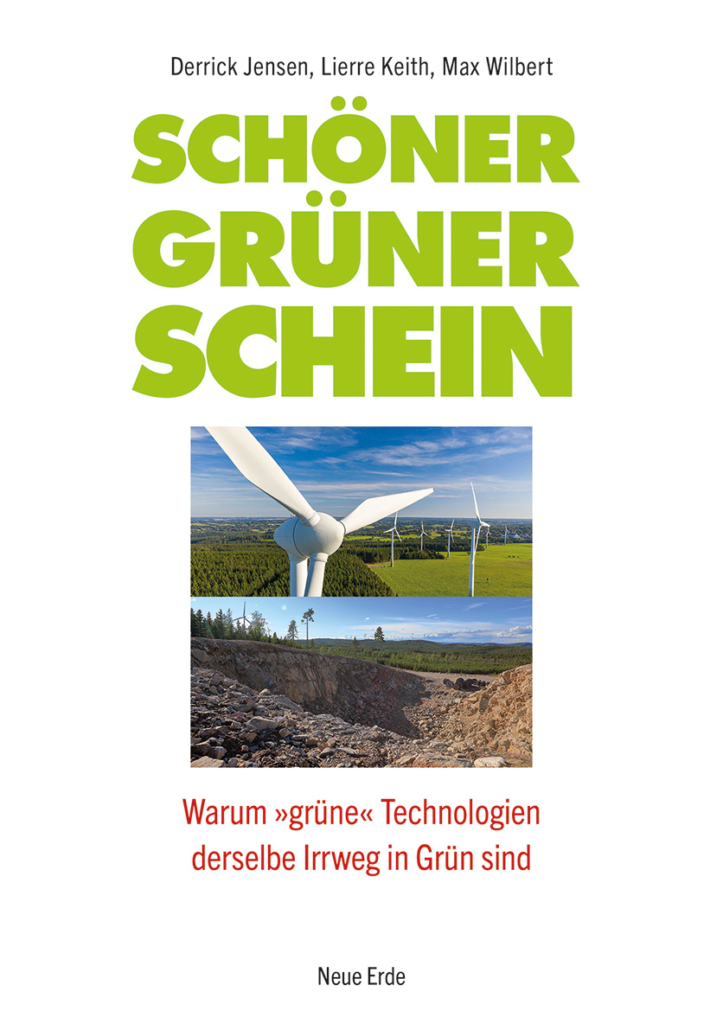Manchmal, wenn ich ganz allein bin mit mir in der Natur – und das können Augenblicke sein –, empfinde ich eine so herzliche Verwandtschaft mit dem Leben um mich, dass ich es umarmen möchte, wie man das eben mit Freunden tut. Dann kann ich schon mal meine Brust an einen Baumstamm drücken und mein Anderssein vergessen, aber dann kommt das Schlimme: Eine Scham steigt in mir auf. Wie kann ich als Erwachsener, als Mensch, einen Baum umarmen! Ist das nicht kitschig?
Zwei schwierige Fragen
Nein, ist es nicht, im Gegenteil. Kitsch ist das Nachgemachte, Unechte. Im Gefühl der Verbundenheit mit der Natur flammt die Erkenntnis auf, dass aus ihr die Quelle unserer Existenz entspringt. Letztlich müsste der Aufruf lauten: Nicht zurück zur, sondern zurück in die Natur! Nur: Wie kann man an einen Ort zurückkehren, an dem man sich ohnehin befindet?
Nötig ist die Forderung „Zurück in die Natur“ geworden, weil wir uns schon vor Jahrhunderten von der Natur verabschiedet haben, auf dass wir sie uns nach Belieben unterwerfen können. Aber kann man etwas unterwerfen, das man selbst ist? Ja, offenbar kann man das; es gelingt, indem man sich geistig-seelisch zweiteilt, eine innerpsychische, kulturelle Schizophrenie herstellt, „die Natur“ als das Fremde abspaltet – und modern wird.
Was wäre ein Fluss ohne Mündung?
„Zurück in die Natur“ bedeutet, die Perspektive wechseln: Nicht die Natur ist für mich da, sondern ich bin für die Natur da oder, noch richtiger für mich: Wir sind einander geschenkt. Ob ich es will und begreife oder nicht, ich reihe mich ein in Ebbe und Flut der Nahrungsketten, liefere meine Moleküle ab an der großen Theke des Lebens zur weiteren Verwendung. In die Natur zurückzukehren, wäre gleichsam das Ende der Besserwisserei, das Ende einer westlichen Haltung, die besagt: „Natur, schön und gut, aber wir können es besser.“ „Zurück in die Natur“ wäre der Weg vom homo arrogans zum homo sapiens.
„Zurück in die Natur“ bedeutet auch, den Tod nicht mehr als Ende, als die Verneinung des Lebens zu verstehen, sondern als die Mündung des Flusses, die uns ins Meer entlässt. Es ist zwar richtig, dass es nach der Mündung keinen Fluss mehr gibt, aber was wäre der Sinn eines Flusses ohne Mündung? Und auch: Was wäre ein Meer ohne Flüsse?
Wir brauchen kein Jenseits
Was ist Seele? So unterschiedlich die Definitionen dafür ausfallen, als Trägerin unserer Lebendigkeit scheint sie uns eine Selbstverständlichkeit. Wer seine Seele aushaucht, der ist nicht mehr, was er zuvor war. Hat denn nicht alles Lebendige Seele, von der Amöbe bis zum Menschen, von der Alge bis zur Rebe? Kann denn ein Lebewesen unbeseelt sein oder umgekehrt: Kann etwas Seelenloses sterben? Niemand käme auf die Idee, von einem gestorbenen Auto zu sprechen oder einer gestorbenen Spülmaschine. Sie sind „kaputt“.
Sind Körper und Seele nicht eins, statt, wie uns weisgemacht wird, gespalten zu sein? Ist nicht die Trennung von Körper und Seele eine Hilfskonstruktion zunächst der monotheistischen Religionen und später des Materialismus, der ohne Seele auszukommen glaubt? Ist ein seelenloses Biotop vorstellbar? Ist das kein Widerspruch in sich? Und sind nicht auch das Wasser dort, die Binsen und Mückenlarven, die Frösche und der Reiher, das Holz und die Steine Teil eines komplexen Ganzen? Nichts davon ist ein beliebig austauschbares „Ding“, sondern Mitgewachsenes und Zugehöriges, aus der Zeit Geborenes. Ist es nicht so, dass es in der Natur nur Ganzes gibt, und wenn wir Teil der Natur sind, dann sind auch wir unteilbar ganz. Wir benötigen kein Jenseits dafür. In einer ungetrennt beseelten Welt können wir uns auch ohne Transzendenz aufgehoben und weitergetragen fühlen.
Essbar sein
Wenn wir also „zurück in die Natur“ wollen – kommst du mit? –, dann verlassen wir die anatomische Perspektive, steigen vom hohen Ross bzw. westlichen Elfenbeinturm und lassen uns überwältigen, öffnen uns für die Schönheit, aber auch für den Tod und das Endliche, die die Grundlage sind für die Vielfalt und überwältigende Fülle des Seins. Dann sind wir bereit, unser nach Sicherheit, Distanz und Dominanz strebendes Ich preiszugeben, um ein neues, integres, weil integrales Ich zu entdecken im Kontakt mit der Welt, die wir sind. Der Hamburger Biologe und Philosoph Andreas Weber geht noch einen Schritt weiter und spricht davon, „essbar zu sein“. Sich nach Unsterblichkeit zu sehnen, sagt er, sei eine „ökologische Todsünde“. Särge sind unser letzter Trennungsversuch, im Sarg sind wir noch nicht essbar für die Würmerwelt, zögern wir unsere Essbarkeit noch ein wenig hinaus; als Asche in der freien Natur wären wir hingegen essbar in einer quasi vorverdauten Form. In der Erkenntnis unserer Essbarkeit vereinigen sich Mystik und Biologie.
Wo endet die Innenwelt?
In die Natur zurückzukehren, heißt anzuerkennen, dass auch unsere Geschwisterwesen eine Innenwelt besitzen, dass sie die Welt subjektiv wahrnehmen, so wie wir auch. Letztlich weiß jeder um die Innenwelt allen Lebens, und einen Schritt weitergedacht: dass eine Wechselbeziehung zwischen Innen- und Außenwelt existiert. Alles fühlt, will heil und gesund sein, kann froh sein oder leiden, alles nimmt wahr, nur nicht unbedingt so wie „wir Menschen“. Aber wer ist schon „wir“? Du als Leserin fühlst anders als ich, die Innenwelt jedes Menschen unterscheidet sich von der des anderen; das ist unsere alltägliche Erfahrung. Und falls du einen Hund hast oder eine Katze, dann trifft das auch auf sie zu, nicht wahr? Letztlich gibt es dieses „wir“ gar nicht, diesen statistischen Querschnitt des Innenlebens aller Menschen, sehr wohl jedoch deine und meine Innenwelt und die aller anderen. So erhebt sich die Frage: Bei welchen Lebewesen, bei welcher Art endet die Innenwelt? Haben nur Lebewesen mit einem dem Menschen ähnelnden Nervensystem eine Innenwelt? Welche Innenwelt haben Vögel, Fische, Schlangen, Insekten, Pflanzen? Andreas Weber konnte unter dem Mikroskop beobachten, wie sich Einzeller furchtsam vor dem tödlichen Tropfen Alkohol auf dem Glas unter der Linse zurückzogen. Wollen schon Einzeller leben? Alles spricht dafür. Nicht nur wir blicken auf unsere Mitwelt, sie blickt auch zurück – und vermutlich vom Menschen dauertraumatisiert.
Radikale Wechselseitigkeit statt Romantik
Wenn wir einen Apfel essen, dann wird er zu einem Teil unseres Körpers; mit anderen Worten: Ein Teil eines Apfelbaums verwandelt sich in dich oder mich. Der Gedanke mag zunächst verblüffend erscheinen, und doch handelt es sich bei diesem Vorgang um den Normalzustand in der Natur und gilt sogar für die Steine, auch wenn deren Verwandlungsprozess hin zum Mineral und damit zum Pflanzennährstoff länger dauert als bei anderen Wesen. Nichts ist auf der Erdoberfläche, das nicht in den großen Stoffwechsel einbezogen wäre, und wer weiß: Vielleicht ist unser Planet ja ein Molekül im Stoffwechsel des Universums?
Hier geht es um keine Hirngespinste, romantischen Gefühle oder Rousseauschen Ideale, sondern um eine notwendige Revolution, wenn wir das Niveau unserer Zivilisation halbwegs aufrechterhalten wollen. Was ansteht, ist eine radikale Wechselseitigkeit und Gegenseitigkeit, die uns von Grund auf erfasst und in der der Mensch auf eine fundamentale Art und Weise Verantwortung übernimmt, wie er sich einer fühlenden, verletzlichen, gleichwürdigen Welt gegenüber verhält. Dann endet die seit Jahrhunderten andauernde Suche nach dem Sinn, weil wir auf eine ganz selbstverständliche Weise in Verbundenheit blühen und weil dieses Blühen nur geschieht, weil jedes Wesen mit dem anderen verschränkt, verknüpft und verwoben ist. Es ist ein Blühen von Geschwistern.
Symbiose statt Kampf
„Zurückkehren in die Natur“ würde bedeuten, respektvoll anzuerkennen, dass die anders-als-menschliche Welt eben nicht aus Dingen besteht, mit denen wir verfahren können, wie es uns beliebt oder gefällt; dass wir auch dann in die Welt eingreifen, wenn wir dort kein Leben erkennen können. Denn jeder Eingriff bleibt ein Eingriff in die Lebensströme und Zusammenhänge der Welt, und nur selten – wenn überhaupt – wissen wir genau um die Folgen unseres Tuns. Schon morgen kann unser Eingriff etwas anderes bedeuten als heute. „Zurück in die Natur“ erkennt: Leben ist Synergie und Symbiose, nicht Kampf. Noch wehren wir uns gegen die Umarmung der Bäume. Deshalb, so Andreas Weber, brauchen wir „eine Revolution der Seele – und eine tiefgreifende Neuausrichtung unserer Beziehungen“. Nur dann haben wir eine Chance auf eine lebenswerte, der bisherigen Gegenwart ähnliche Zukunft.
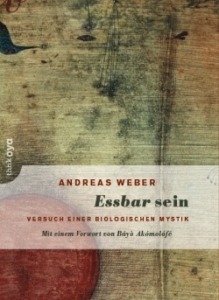 Zur Vertiefung: Andreas Weber, Essbar sein. Versuch einer biologischen Mystik, Verlag thinkOya, ISBN 978-3-947296-09-5, 26,80 Euro
Zur Vertiefung: Andreas Weber, Essbar sein. Versuch einer biologischen Mystik, Verlag thinkOya, ISBN 978-3-947296-09-5, 26,80 Euro




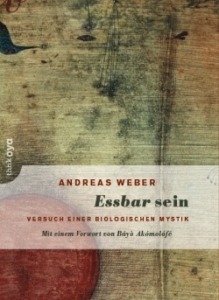 Zur Vertiefung: Andreas Weber, Essbar sein. Versuch einer biologischen Mystik, Verlag thinkOya,
Zur Vertiefung: Andreas Weber, Essbar sein. Versuch einer biologischen Mystik, Verlag thinkOya, 


 Schluss mit dem Kampf gegen Windmühlen
Schluss mit dem Kampf gegen Windmühlen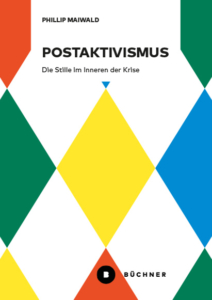 Phillip Maiwald
Phillip Maiwald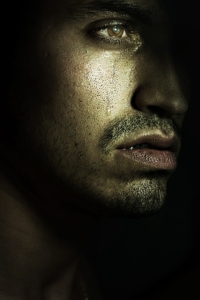 Vom Wert der Tränen
Vom Wert der Tränen Hüter/innen der Erde
Hüter/innen der Erde