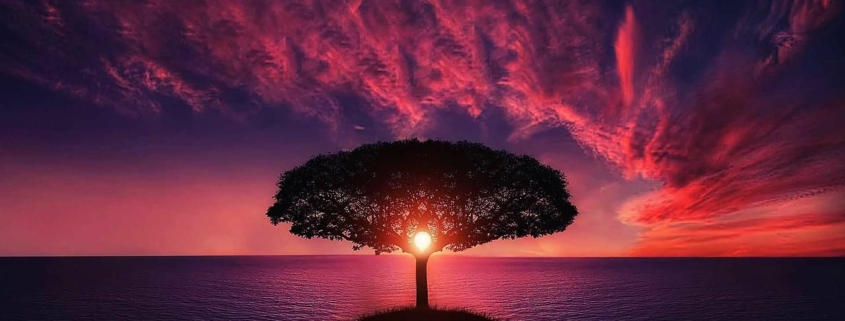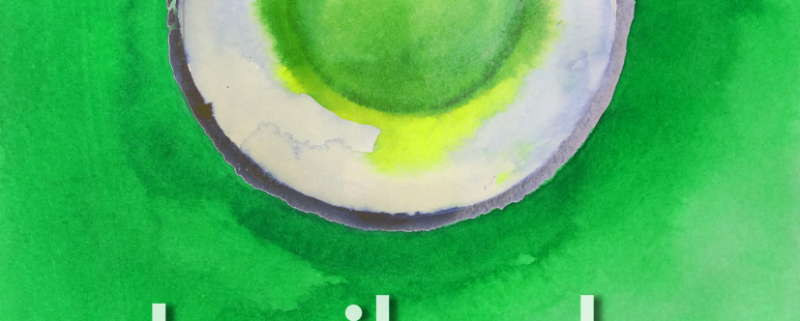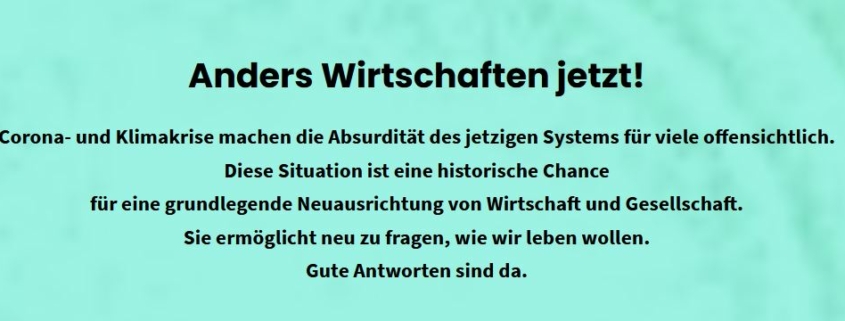Bobby Langer: Jascha, dein kürzlich erschienenes Buch „Die große Kokreation“ bezeichnet sich als „Standardwerk für transformative Kokreation in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft“. Ist das ein Buch für Spezialisten bzw. Experten, also zum Beispiel Soziologen oder Politologen, oder schreibst du für eine breitere Zielgruppe?
 Jascha Rohr: Ich schreibe für alle, die sich engagieren, die Dinge bewegen und verändern wollen und wissen, dass das gemeinsam besser geht als alleine. Das ist, so hoffe ich, eine sehr breite Zielgruppe, die Expert:innen einschließt, sich darüber hinaus aber auch an Führungskräfte, Aktivist:innen, Unternehmer:innen, Projektleiter:innen, lokal Engagierte und viele mehr richtet, die den Anspruch haben, mit ihrer Arbeit einen positiven Beitrag zur Gestaltung der Welt zu leisten.
Jascha Rohr: Ich schreibe für alle, die sich engagieren, die Dinge bewegen und verändern wollen und wissen, dass das gemeinsam besser geht als alleine. Das ist, so hoffe ich, eine sehr breite Zielgruppe, die Expert:innen einschließt, sich darüber hinaus aber auch an Führungskräfte, Aktivist:innen, Unternehmer:innen, Projektleiter:innen, lokal Engagierte und viele mehr richtet, die den Anspruch haben, mit ihrer Arbeit einen positiven Beitrag zur Gestaltung der Welt zu leisten.
B.L.: Was verpasst man, wenn man es nicht gelesen hat?
J.R.: Das Buch ist voller Modelle, Methoden, Theorie und Praxis, so dass wir zu informiert Handelnden werden können. Ich persönlich sehe den wertvollsten Beitrag des Buches aber darin, dass es ein neues ökologisches Paradigma anbietet, mit dem wir die Prozesse von Entwicklung, Veränderung und Gestaltung viel besser verstehen und anwenden können.
B.L.: Du sagst, es gehe dir um die „Neuerfindung unserer planetaren Zivilisation“. Das klingt im ersten Moment ziemlich abgehoben. Weshalb hältst du diese Neuerfindung für notwendig?
J.R.: Das ist natürlich erst einmal eine Provokation. Und eine homogene globale Zivilisation gibt es in diesem Sinne auch gar nicht. Aber klar ist: Wenn wir global so weitermachen wie bisher, zerstören wir unsere Lebensgrundlagen und damit das, was wir Zivilisation nennen. Das kennen wir aus der Vergangenheit der Menschheit im Kleinen. Da konnte es dann aber immer an anderer Stelle weitergehen. Kollabieren wir heute als globale Zivilisation, gibt es keinen Ausweichplaneten. Diesmal muss es uns gelingen, uns neu zu erfinden, bevor wir komplett kollabieren. Das nenne ich Neuerfindung unserer Zivilisation.
B.L.: Wer bist du, um sagen zu können, du wärest zu einer solchen Konzeptleistung in der Lage?
J.R.: Mein Beruf ist es, seit ca. 25 Jahren kleine und große Gruppen darin beizustehen, sich selbst neu zu erfinden – vom Dorf bis zur nationalen Ebene habe ich Beteiligungs- und Gestaltungsprozesse konzipiert und begleitet. Meine Leistung dabei ist es, den Prozess zu strukturieren und zu halten, in dem diese Gruppen sich selbst erfinden. Ich bin so etwas wie eine Gestaltungshebamme. In diesem Sinne würde ich mir auch nicht anmaßen, alleine unsere Zivilisation neu zu erfinden. Aber ich fühle mich gut darauf vorbereitet, auch große internationale und globale Prozesse zu konzipieren, methodisch zu unterstützen und zu begleiten, in denen die Beteiligten miteinander beginnen, „Zivilisation“ neu zu erfinden.
B.L.: Gibt es nicht mehr als eine Zivilisation auf dem Planeten? Wenn du also von „planetarer Zivilisation“ sprichst, klingt das so, als würdest du die westliche, industriell geprägte Zivilisation mit der planetaren gleichsetzen?
J.R.: Ja genau, das klingt so, dessen bin ich mir bewusst, und das ist natürlich nicht so. Und doch gibt es so etwas wie eine globale diverse Gesellschaft, globale Märkte, eine globale politische Arena, eine globale Medienlandschaft, globale Diskurse, globale Konflikte und globale Prozesse, zum Beispiel in Bezug auf Corona oder den Klimawandel. Dieses sehr heterogene Feld nenne ich vereinfacht globale Zivilisation, um klarzumachen: Dieses globale Feld ist in seiner Ganzheit eher toxisch als heilsam. Es muss transformiert werden im Sinne einer globalen Regeneration.
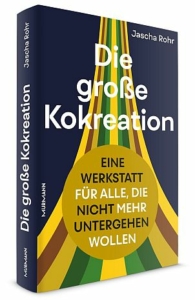 B.L.: Du schreibst ein ganzes Buch lang über Methoden und Werkzeuge. Hast du keine Sorge, dass deine Zielgruppe auf Inhalte pocht?
B.L.: Du schreibst ein ganzes Buch lang über Methoden und Werkzeuge. Hast du keine Sorge, dass deine Zielgruppe auf Inhalte pocht?
J.R.: Das ist die Krux. Es gab viele, die hätten sich lieber ein einfaches Rezeptbuch gewünscht: Lösungen zum Nachmachen. Und genau da wollte ich ehrlich bleiben: Aus dieser Rezeptlogik müssen wir aussteigen, sie ist Teil des Problems. Nachhaltige Lösungen haben immer damit zu tun, dass wir lokale Kontexte verstehen und dafür angepasste Lösungen entwickeln. Das habe ich aus der Permakultur gelernt. Dazu müssen wir uns trainieren und ausbilden. Dafür braucht es Methoden und Werkzeuge. Den Rest müssen die Kokreator:innen vor Ort leisten.
B.L.: Du schreibst: „Benutzen wir … die Werkzeuge der alten Zivilisation, kann nur eine neue Version der alten Zivilisation dabei herauskommen.“ Das ist logisch. Nur: Wie willst du als Kind der alten Zivilisation Werkzeuge einer neuen Zivilisation finden?
J.R.: Das geht nur über Transformationsprozesse. Und ich benutze diesen Begriff nicht leichtfertig, sondern in aller Konsequenz und Tiefe: Jede:r, der oder die mal einen Kulturschock erlebt hat und sich in eine neue Kultur einleben musste, der oder die eine religiöse Einstellung geändert hat, das berufliche Leben neu begonnen hat oder eine langfristige Beziehung für eine neue verlassen hat, kennt solche einschneidenden Veränderungsprozesse. Ich selbst habe meine ganz persönlichen Krisen und Auseinandersetzungen gehabt, in denen ich immer wieder zumindest Aspekte der „alten Zivilisation“ persönlich transformieren konnte. Meine Gründungen der Permakultur Akademie, des Instituts für partizipatives Gestalten und der Cocreation Foundation waren jeweils von genau solchen Erkenntnisprozessen getragen, die dann ihren gestalterischen Ausdruck in diesen Organisationen gefunden haben. Aber natürlich bin auch ich noch verhaftet, ich verstehe mich als Mensch in Transition.
B.L.: Obwohl du deine Augen nicht vor der Lage der Menschheit verschließt („Der Einsatz ist hoch, die Welle gefährlich, möglicherweise tödlich“), ist der Grundtenor deines Buches ausgesprochen positiv. Woher nimmst du deinen Optimismus?
J.R.: Der Optimismus ist eine Überlebensstrategie. Ohne ihn hätte ich gar nicht die Kraft, das zu tun, was ich tue. Woher sollen wir die Energie für so viel Wandel und Gestaltung nehmen? Ich glaube, dass wir das nur schaffen, wenn wir aus dieser Aufgabe Kraft, Freude, Lebendigkeit und Fülle für uns schöpfen. Ich mache das mit Hoffnung spendenden Narrativen. Wenn ich mich damit selbst manipuliere, nehme ich das gerne in Kauf: Lieber eine positive selbsterfüllende Prophezeiung als eine negative!
B.L.: Das Buch war der Band 1. Was können wir von Band 2 erwarten?
J.R.: In Band 1 haben wir den Werkzeugkoffer gepackt und uns den Kollaps und die Vision angeschaut. In Band 2 gehen wir in die Transformation, in die Höhle des Monsters sozusagen. Die drei bestimmenden Themen werden sein: Resonanz, Trauma und Krise. Heftiger Stoff, aber auch unglaublich spannend! Ich forsche gerade sehr stark dazu, was es in Gruppen heißen kann, das kollektive Nervensystem zu beruhigen, zu regulieren und Traumata zu integrieren. Ich glaube – eine weitere grobe Metapher –, dass unsere globale Zivilisation sich am besten mit einer Suchtanalogie beschreiben lässt: Wir sind süchtig nach Energie und Konsum. Eine nachhaltige Regeneration wird uns nur gelingen, wenn wir von der Nadel kommen. Das ist keine einfach zu lösende Sachthematik, sondern ein kollektivpsychologisches Problem. Aber meine Arbeitsweise ist ja generativ, ich bin selbst gespannt, was im weiteren Schreibprozess passiert.
Jascha Rohr, Die große Kokreation. Eine Werkstatt für alle, die nicht mehr untergehen wollen. 400 S., 39 Euro, Murmann Verlag, ISBN 978-3-86774-756-1